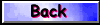Wirth Hans Jürgen: Gefühle machen Politik. Populismus, Ressentiments und die Chancen der Verletzlichkeit. Psychosozial-Verlag, 2022, 336 Seiten
Der Autor legt hier einen Text vor, der differenziert Erklärungsmodelle für den Rechtsruck in den Gesellschaften, besonders aber in der BRD, anwendet. Er ist sich bewusst, dass dies im Vergleich mit einem historischen Text ein schwieriges Unterfangen darstellt, da wir Verlauf und Ausgang der Entwicklung nicht kennen, eben nicht retrospektiv auf ein Geschehen blicken können. Wirth steht wohl in der Tradition von Horst Eberhard Richter, der sich nicht scheute gesellschaftliches Geschehen aus psychoanalytisch sozialpsychologischer Perspektive zu kommentieren.
Ein Mangel des Textes zieht sich allerdings durch: Wirth unterscheidet nicht deutlich zwischen Gefühl und Affekt. Strenggenommen müsste mensch wohl sagen, dass eben Affekte Politik machen – dass ist ja gerade das Vertrackte. Wären es Gefühle, dann ginge es nicht um unreflektiertes Agieren, sondern um Verbindendes; Gefühle verbinden – Affekte trennen. Aber der Titel trägt vermutlich zum besseren Verkauf bei und dem Buch wäre tatsächlich eine breite Leserschaft zu wünschen.
Die Leipziger Autoritarismusstudie von 2018 kam zu dem Schluss, dass rechtsextreme und populistische Einstellungen hauptsächlich mit hohen Werten bei Autoritarismus, dem Gefühl mangelnder Anerkennung als Bürger:in, verweigerte Anerkennung als Kind durch die Eltern und misstrauische Grundhaltung gekennzeichnet sind (S. 31). Die fehlende positive Bindung, wird durch den Hass ersetzt, bei dem sich der Mensch in das Gehasste geradezu verbohren muss, was eben eine Form pathologischer Bindung darstellt.
»Hass ist getrieben von dem Durst nach Rache und „besteht in der Demütigung, Misshandlung, letztlich in der Vernichtung des Gegners. Ja, tiefster Hass kann den Feind selbst noch über den Tod hinaus verfolgen. In dieser prinzipiellen Unerfüllbarkeit liegt bereits eine radikalisierende Tendenz - der maligne Hass nimmt nicht ab, sondern eher zu [..]" (Fuchs, 2021, S. 327f). Deshalb kann der Hass auch „gehegt, genährt und gewissermaßen bis zum Tag der Rache aufgespart werden, an dem sich seine angesammelte Energie mit einem Mal freisetzt“ (ebd, 328)« (S. 45 f).
Diesem Affekt geht eine lange Vorgeschichte von Demütigungen, Erniedrigungen, Entwertungen und verschiedenster Formen narzisstischer Kränkungen voraus. Vermutlich wird Donald Trump in den USA demnächst exerzieren, welche fatalen Folgen dies für die Menschheit und ihre Kulturen haben wird. Der Karl Kraus zugeschriebene Satz: „In Friedenszeiten diagnostizieren wird sie, in Krisenzeit regieren sie uns“ hat noch immer Gültigkeit. So einen schwer gestörten Menschen hatten wir schon mal in Deutschland an der Regierung – dies darf sich nicht wiederholen.
Wirth diskutiert die Affekte Angst, Hass, Neid, Ekel, Verbitterung und Ressentiment. Ebenso Scham, eines eher komplexen Gefühls, dass aber bereits mit Wertsetzung durch wichtige Andere einher geht. Z.B. meine ich, dass Neid ein Affekt ist, der auf den Affekt der Eifersucht zurückgeht. Die Eifersucht wird in der kapitalistischen Welt der materiellen Besitztümer auf diese projiziert. Und wenn noch heute vom Neid der Besitzlosen die Rede ist, dann wird das Grundproblem der Ungerechtigkeit auf ein primitives Neidgefühl reduziert, wodurch die Verletzung des Wertes der Gleichheit und die Problematik der Ungleichverteilung nicht mehr diskutiert wird. Dies gilt ebenso bei der Wortwahl der "Superreichen", als wäre die Tatsache, riesige Vermögen anzuhäufen etwas Großartiges. Faktisch sind es "Überreiche", die einfach zu viel besitzen und durch allerlei Tricks keine Steuern zahlen, somit die eigentlichen Schmarotzer der Gesellschaften.
Der soziale Abstieg, real oder gefürchtet, wird als "Kulturschock" oder" Geltungsverlust" erlebt, was enorm kränkend sein kann. Dazu gehören die Erfahrungen mit der Globalisierung, der digitalen Revolutionierung des Arbeitslebens. [Allerdings wird im Kapitalismus wenig getan, um die Folgen solcher Ereignisse abzumildern, führt das Oben-Unten-Denken, die Gewinner-Verlierer-Einstellung, letztlich der Mangel an Miteinander, Kooperation und gegenseitiger Hilfe in der Entwicklung zum Empfinden des eigenen Versagens: "wer arbeiten will, der findet auch Arbeit", BK.] (S. 67).
Gauland etwa nutzt und zitiert, was die Leute sagen. »"Das ist ja der Fehler der etablierten Parteien und Politiker, dass sie total abgehoben sind und gar nicht wissen, was das einfache Volk denkt"« (S. 72). Durchaus bedient er so die dumpfen Ressentiments, denen ein Fünkchen Wahrheit anhaftet. Allerdings nur um seine eigenen Machtambitionen zu verfolgen. Aufklärend kritisieren will er nicht. »Die Form des Fälschens und Lügens, die Alexander Gauland praktiziert, kennzeichnet Max Scheler (1955 [1915] S. 110) mit dem Begriff der „organischen Verlogenheit“« (S. 78).
Wirth zeigt an einzelnen Therapiebeispielen, wie sich persönliche Problematik an die politischen Aussagen der Demagogen heften können, wie die Bürger:innen aus unreflektierten Ressentiments ‚dankbare‘ Opfer der Rattenfänger werden. In dieser Argumentation liegt eine grundsätzliche Gefahr: Persönliche Charakterdeformationen können zu einer Erklärung für den Aufwind der AFD oder der Trump(el) dieser Welt verwandt werden. Das verstellt den Blick auf desolate gesellschaftliche Strukturen, die in hohem Maße von politischen Führern zu verantworten sind. Wirth ist davon weit entfernt (S. 99 ff.) – und doch schleicht sich dieser Eindruck immer wieder zwischen die Zeilen.
Klar macht Wirth das von Macht getriebene Vorgehen in Bezug auf den Brexit deutlich. Machtpolitische Ambitionen vom damaligen Premierminister Cameron führten in einen problematischen Volksentscheid, in dem die wachsenden Ressentiments die Oberhand gewannen. »“Die ganz gemeine Eitelkeit als Berufskrankheit bei Politikern“ (Max Weber)« war wieder einmal die treibende Kraft (S. 88). Getrieben von ihrem pathologischen Narzissmus der im Establishment aufgewachsener Kinder, griffen sie die realen sozioökonomischen Verwerfungen auf, ohne sich um deren Beseitigung zu kümmern. Sie richteten »einen Scherbenhaufen an, wie er häufig nach den Saufgelagen des ebenso „berüchtigten wie exklusiven“ Oxforder Studentenvereins "Bullingdon Club", dem beide (Cameron und Johnson, BK) angehörten, zurückblieb« (S. 91). In Great Britain schwelte die Kränkung des Gruppennarzissmus, der aus dem Verlust der imperial-kollonialen Stellung in der Welt erwuchs, des britischen Empire, in dem die Sonne nie untergeht (92 ff.).
Hinsichtlich des „Macht- und Geltungsstrebens“ politischer Akteure erwähnt Wirth Alfred Adler nicht, auf den diese Begrifflichkeit zurückgeht, der die Kultur geradezu als zerfressen vom Machtstreben bezeichnet hat. Für die Anhänger von Verschwörungstheorien bringt unser Autor Erik H. Erikson mit seinem Theorem des Urvertrauens in die Diskussion ein. Mit Bezug auf Fonagy, der Eriksons Begriff erweiterte, bescheinigt Wirth den Anhängern von Verschwörungstheorien ein „epistemisches Misstrauen“. Sieht mensch die politischen Gestalter als projektive Elternfiguren an, dann finden die durch problematische Bindungserfahrungen geschädigten Menschen, die Unzuverlässigkeit und Unglaubwürdigkeit ihrer Erfahrung mit ihren Eltern hier wieder.
Nach Tschernobyl und Fukushima gerieten auch die Naturwissenschaften in Misskredit. War schon die Schulmedizin in der Wahrnehmung linksalternativ orientierter Menschen in Verruf geraten, so zeigte sich das „epistemische Misstrauen“ in der Corona-Krise geradezu explodierend. Selbst Menschen, die bereits lebensbedrohlich an Covid 19 erkrankt waren, ließen sich nicht schulmedizinisch behandeln, schworen auf die Homöopathie und starben „lieber“, evtl. in suizidaler Absicht, ohne dass dies transparent wurde. Teilweise wurden die Corona-Demonstrationen zu karnevalistischen Happenings, bei denen musizierend und tanzend zwar das Virus nicht vertrieben wurde, aber die unterschwellige Angst; zugleich sollte den Mächtigen - wie im Karneval – gezeigt werden, dass mensch ihre autoritären Verbote und Gebote, ihre Angstmacherei vor Tod und Teufel verlacht. Ein wesentliches Kriterium zur Unterscheidung zwischen einer emanzipatorischen, kritischen Haltung und einer verschwörungstheoretischen besteht darin, dass erstere sich auf Fakten bezieht, vor allem offen für einen kritischen Dialog bleibt. Die anderen spalten eher in Gut und Böse, sind selbst dann nicht bereit zu kritischer Revision, wenn sie selbst schwer an Corona erkranken, um so ihr Selbst stabilisierendes, Ressentiment geladenes Weltbild nicht aufgeben zu müssen (S. 131).
In Krisenzeiten steigen sonst eher weniger beachtete Formen magischen Denkens an die Oberfläche. Neben der Renaissance etablierter Religionen, greifen der Glaube an Horoskope, Glücksbringer (20 bis 30% der Menschen glauben daran), Zukunftsvorhersagen, Glaube an die Reinkarnation, übernatürliche Heilkräfte oder das Suchen des Heils in der Spiritualität, Raum (S. 133). Letztere hat inzwischen auch ihren Platz in der Psychotherapie gefunden.
Seit Hannah Arendt ist die »Banalität des Bösen« der stehende Begriff für die erschreckende Normalität der NS-Schergen. Auch Harald Welzer sieht den Kern der Mittäterschaft darin, dass die Menschen sich im Dienste einer Aufgabe wähnten, »"die ihnen die historischen Umstände zu diktieren schienen (Welzer, 2005, S. 371)"« (S. 137). Die Menschen, die in Ruanda ihre Nachbarn mit der Machete abschlachteten, bezeichneten dies als »Arbeit des Tötens«. Eichmann und andere Nazi-Täter wurden verschiedentlich von untersuchenden amerikanischen Psychiatern als erschreckend normal bezeichnet. Harry Stack Sullivan prägte den Begriff der »Normopathie«. Und der Bezug zur kapitalistischen, neoliberalen Einstellung wird deutlich, wenn ein Militärpsychiater von einer durchschnittlich zu erwartenden Durchsetzungsfähigkeit hinsichtlich der untersuchten Nazi-Oberen, denen in Nürnberg der Prozess gemacht wurde, spricht.
»"Sie waren wie jeder andere aggressive, gerissene, ehrgeizige und rücksichtslose Geschäftsmann..." (Kelly, zit.n. El-Hai, 2014, S. 189)« (S. 139).
Kernberg beschrieb solche Personen als maligne Narzissten. Sie betrachten ihre Nebenmenschen nur unter dem Aspekt der Nützlichkeit für ihre eigenen Interessen. [So kommen dann auch Termini wie, ’Humankapital’ zustande]. Bereits 1894 hat der Historiker Ludwig Quidde in seiner Caligula Studie den Cäsarenwahn hervorgehoben. »"Größenwahn, gesteigert bis zur Selbstvergötterung, Missachtung jeder gesetzlichen Schranke und aller Rechte fremder Individualitäten, ziel- und sinnlose Grausamkeit" (Quidde, 1977 [1894], S. 67) nennt er als die auffälligsten Symptome« (S.141). Menschen mit antisozialen Persönlichkeitsstörungen werden in entsprechenden machtpolitischen Strukturen zum legitimen Ausleben ihrer Gewaltphantasien eingesetzt. Sind bei der individuellen narzisstischen Störung oft genug Gewalttraumatisierungen in der Kindheitsentwicklung auszumachen, die bei dem Angebot fanatischer Ideologien zur Abwehr der so entstandenen paranoiden Ängste genutzt werden können, sind gesellschaftliche Massenbewegungen komplexer. Es sind die geteilten Affekte [nicht »Gefühle«], die kollektive Wir-Identitäten schmieden, die von passenden Demagogen geschürt und verschmolzen werden. Ressentiments, Kränkungen des Gruppennarzissmus und kollektive Traumata sind die Zutaten einer gefährlich, krankhaften Mischung! (S. 145 ff.). Mit Welzer gesprochen, waren es »“ganz normale Männer, gutmütige Familienväter und harmlose Durchschnittsmenschen“ [die] das pathologische nationalsozialistische Größenselbst in sich auf[nahmen], doch ohne dessen gewahr zu werden, weil es der herrschenden Norm entsprach« (S. 150). Hier möchte ich allerdings noch zu bedenken geben, die die »harmlosen Durchschnittsmenschen« u.a. in einer preußischen Tradition des Autoritarismus standen, einer Schule der Gefühlsverhinderung.
Im fünften Kapitel spannt Wirth einen weiten Bogen der deutschen Geschichte von der Nazizeit und ihren Folgen bis hin zu einer "Willkommenskultur". Vier Traumata prägten die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. 1. Die kurze Zeit zwischen den zwei Weltkriegen, im letzten mit der Vernichtung von 35 bis 40 Millionen Menschen. 2. Der Holocaust stellte einen Zivilisationsbruch dar, dessen schockierende Wirkung zur Leugnung der Shoa sowohl in Deutschland als auch in Israel führte. 3. Der Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki, der nicht nur zu unsäglichem Leid und Traumatisierungen der japanischen Bevölkerung führte, sondern auch verdeutlichte, dass die Menschheit nunmehr in der Lage ist, sich selbst als Gattung auszulöschen. 4. Die Vertreibung von 12 bis 15 Millionen Deutschen nach der »Neuordnung der Grenzen«, wiederum mit individuellen und kollektiven Traumatisierungen verbunden.
Als weltweites Abwehrphänomen kann die »Unfähigkeit zu trauern« (Margarete und Alexander Mitscherlich, 1967), sowie die Begeisterung für die friedliche Atomnutzung, angesehen werden.
Auf mehreren Seiten befasst sich Wirth mit der sozialpsychologischen Interpretation der Wählerschaft von AFD und Grünen (S. 191 ff.). Empirische Daten offenbaren z.B., dass die AFD seltener von Frauen gewählt wird (S. 205). Das hängt auch damit zusammen, dass in der AFD alte patriarchale Anschauungen bedient werden, die an Strukturen des autoritären Charakters (Fromm) anknüpfen. Die Männer, meist mit geringerem Bildungsgrad, werden als die »psychologischen Verlierer der Bildungsexpansion« (S. 207) bezeichnet. In den Studien werden AFD Wähler:innen durch folgende Einstellungen charakterisiert: »Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Sozialdarwinismus, Verharmlosung des Nationalsozialismus, Akzeptanz der Gewalt durch andere, Verschwörungsmentalität, Chauvinismus, Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit" (S. 219 f). Interessanterweise zeigen Grünen wie AFD Wähler:innen hohe Narzissmuswerte. Das lasse sich mit der psychoanalytischen Differenzierung in pathologischen und gesunden Narzissmus verstehen. Die Grünen zeigen dann eher ein auf positiven Kindheitserfahrungen gewachsenes Selbstbewusstsein. AFD (und Linke) Wähler:innen lassen sich eher dem Typus der narzisstisch Gekränkten, die der Grünen eher dem der erfolgreichen Selbstverwirklicher:innen zuordnen. Im AFD Umfeld wird einem Männlichkeitskult gefrönt, der Stärke und Unverletzlichkeit suggeriert. Das Bewusstsein der Verletzlichkeit des Menschlichen, ja alles Lebendigen, ist im Zuge des Machbarkeitswahns in den Hintergrund getreten. Dabei ist die Verletzlichkeit ein Anthropinion, ein Wesensmerkmal, des Menschen, eigentlich alles Lebendigen. Wirth unternimmt den Versuch begrifflicher Klärung. So differenziert er zwischen Vulnerabilität (Verletzbarkeit) und Trauma. Erstere ist ein länger andauernder Zustand, der aber nicht zwingend zu einem Trauma führen muss.
»Trauma ist eine Grenzsituation des Lebens, Verletzlichkeit ist hingegen eine „permanente Möglichkeit des Daseins“ (Pugliese, 2017, S. 360). „Vulnerabilität ist eine Daseinsstruktur. Sie ist aus der menschlichen Existenz genau so wenig wegzudenken wie reale Verletzungserfahrungen“ (Flaßpöhler, 2021, S. 207)« (S. 243).
Die Verletzlichkeit resultiert aus der Frühgeburtlichkeit des Menschen (Portmann), weshalb der Mensch auf den Mitmenschen hin orientiert ist, Liebe, Wertschätzung, Einfühlung und Nähe die tragenden Elemente menschlichen Seins sind (S. 249).
ZEITENWENDE
Das Buch war schon abgeschlossen, da traf die Weltgemeinschaft der Überfall Russlands auf die Ukraine. Wirth liefert im 8. Kapitel eine sozialpsychologische Einschätzung von Putins Motivation, die sich im Wesentlichen aus der narzisstischen Kränkung der Auflösung der Sowjetunion speist, der er mit imperialen Größenphantasien begegnet.
Wes Geistes Kind Putin ist, zeigte sich nicht nur in seinen Männlichkeitsposen mit nacktem Oberkörper hoch zu Ross, sondern auch in seiner Rücksichtslosigkeit gegenüber Angela Merkel, von deren Hundephobie er wusste, gleichwohl bei ihrem Besuch im Kreml in sadistischer Freude seine Labradorhündin frei herumlaufen ließ. Dass Merkel an dem Projekt Nordstream 2 festhielt und so die Abhängigkeit von russischem Gas und Öl beförderte, ist »allem Anschein nach« auf den Druck der deutschen Wirtschaft zurückführen, die weiter mit den billigen Rohstoffen aus Russland produzieren wollte.
Da in der BRD eine immerhin heftige Auseinandersetzung mit den Traumatisierungen durch den Naziterror und den Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat, gibt es keine Ressentiment geladenen Reaktionen - anders als die Gewaltexzesse der russischen Soldaten (Butscha), die sich aus der uneingeschränkten Gewalterziehung in zaristischer Tradition erklären lassen. Dazu stimmt auch die Wiedereinsetzung der Stalin-Verehrung durch Putin.
»Unter Putins Herrschaft wurde diese Auseinandersetzung mit der Stalin-Zeit jedoch schrittweise immer mehr unterbunden und machte schließlich sogar einer Stalin-Verehrung Platz« (S. 297).
Was seit Gorbatschows Perestroika und Glasnost an kritischer Auseinandersetzung mit der russischen Geschichte begonnen wurde, fand unter Putin ein Ende.
»Wie der MDR [Mitteldeutschen Rundfunk] zeigte, wurde Stalin 2017 zum „größten russischen Helden aller Zeiten“ gewählt« (S. 297).
Die 2001 im Bundestag auf Deutsch gehaltene Rede Putins nehmen »Putin-Versteher« als Beleg für seine ursprünglich hehren Absichten, »Putin-Kritiker« hingegen sind rückblickend überzeugt, dass er die Abgeordneten mit großem Geschick täuschte. Putins paranoide Tendenzen, der Westen wolle ihn vernichten, fanden Nahrung in der schon am 8. Januar 1992 von George H. W. Bush im Kongress stolz vorgetragenen Behauptung, »Amerika habe den Kalten Krieg gewonnen („By the grace of God we won the Cold War“)« (S. 300). Und Barack Obama kränkte weiter mit seiner »verächtlichen Bemerkung, Russland sei keine Groß- sondern nur eine Regionalmacht. Beide Auslassungen waren äußerst fahrlässig und unklug, weil sie Putins Nationalstolz gekränkt haben« (S. 300).
Gemäß der psychoanalytischen Entdeckung von der Wiederkehr des Verdrängten, führt die Verleugnung der russischen kollektiven Traumata zu deren Wiederkehr. Dazu gehören die Gewalt durch Stalins Terrorherrschaft, die Erziehung, das Verhältnis zwischen den Geschlechtern in Formen alltäglicher Gewalt als Konfliktlösungsstrategie, die Gewaltausübung und Demütigung in der militärischen Ausbildung durch sadistische Vorgesetzte (S. 303).
Während Macrons Besuch zitierte P[l]utin aus einem russischen Lied: »Ob es dir gefällt oder nicht, du wirst dich fügen müssen, meine Schöne« (S. 304). Dies ein weiteres Beispiel dafür, wie vulgäre und von Gewalt geprägte Sprache das Denken vergiftet.
Der Krieg gegen die Ukraine wird schwerste Traumatisierungen auf beiden Seiten zur Folge haben, die hoffentlich nach seinem Ende einen tiefgreifenden Aufarbeitungsprozess in Gang setzen werden.
Bernd Kuck 
Dezember
2024
|

|
In der nächstgelegenen
Buchhandlung! So landen die Steuereinnahmen zumindest in
"unserem" Steuersäckel, was theoretisch eine
Investition in Bildung und Erziehung ermöglichen würde.
In Bonn-Bad Godesberg z.B. in der
Parkbuchhandlung

Oder finden Sie hier eine Buchhandlung in
Ihrer Nähe:
Buchhandlung finden
|