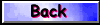Hustvedt Siri.: Die zitternde Frau. Eine Geschichte meiner Nerven. 240 S., Rowohlt Verlag, Berlin. 2010 (Originalausgabe: The Shaking Woman or A History of My Nerves. Hodder & Stoughton, London 2010)
Siri Hustvedt, Jg. 1955, ist eine amerikanische Schriftstellerin und Essayistin von Rang und Namen - Was ich liebte (2003), A Plea for Eros - Essays (2006), Die Leiden eines Amerikaners (2008). Ihr jüngstes Buch, "Die zitternde Frau. Eine Geschichte meiner Nerven", berichtet von ihrem häufigen Leiden, wenn sie in der Öffentlichkeit redet, an unkontrollierbarem Zittern am ganzen Körper vom Hals abwärts, ohne dass ihre Stimme in Mitleidenschaft gerät. Erstmals aufgetreten ist dieses konvulsivische Zittern bei einer Gedenkrede für ihren verstorbenen Vater 2006, zweieinhalb Jahre nach seinem Tod. Neurologisch, psychiatrisch, gar psychoanalytisch blieb (und bleibt) ihr Leiden unerklärlich; lange meinte sie, es könne eine konversionshysterische Trauerreaktion sein; später wurde ein Verdacht auf Epilepsie geäußert. Seit ihrer Kindheit leidet sie unter schweren Migräne-Attacken; sie bezeichnet sich selbst als eine hypersensible Person, die auf Farben, Geräusche und das Leiden anderer Menschen stark reagiert. Ihr Zittern ließ sich in keine herkömmliche diagnostische Kategorie einpassen.
Zwei Jahre lang nahm Hustvedt an einer neuropsychoanalytischen Diskussionsgruppe hochkarätiger Neurowissenschaftler teil. Ehrenamtlich leitete sie in der renommierten Payne Whitney Psychiatric Clinic eine therapeutische Schreibwerkstatt für PatientInnen an und sammelte mit ihnen zusammen wertvolle Erkenntnisse zu deren individuellem Leidengeschehen. Da wie dort vertiefte sie sich in die menschlichen Geheimnisse seelisch-körperlicher Leidensgeschichten und Prozesse. Derweil stürzte sie sich "mit Wissbegier in die Mysterien meines eigenen Nervensystems" und begab sich auf eine weitreichende interdisziplinäre Suche nach Antworten auf grundlegende Lebensfragen: die Beziehung von Körper und Seele, von Geist, Gehirn und Psyche, vom Wesen des Gedächtnisses und vom Selbst. Dabei arbeitete sie sich in die Denk-, Sprach- und Erkenntniswelten von Neurologie, Psychiatrie, Psychoanalyse und Neurobiologie ein. Reichliche Fallbeispiele entnimmt sie sowohl der Fach- als auch der Romanliteratur.
Der vorliegende, sehr persönlich geschriebene narrative Essay berichtet von ihren Begegnungen mit Fachärzten, Wissenschaftlern und Patienten sowie von den Erkenntnissen und Erlebnissen, die ihr auf der Suche nach dem Grund ihres Leidens widerfahren sind. Die Geschichte meiner Nerven fesselt wie ein Roman und ist zugleich eine einmalige Einführung in diesbezügliche neuere neurowissenschaftliche und psychiatrisch-psychoanalytische Erkenntnisse. Der Neurowissenschaftler Mark Solms, Autor von Das Gehirn und die innere Welt: Neurowissenschaft und Psychoanalyse (2004), kommentiert:
"Mich machte Die zitternde Frau sehr betroffen. Nicht nur zeigt es eine fast komplette Beherrschung (durch einen Laien) des hochgradig spezialisierten Gebietes der Neuropsychiatrie, es zeitigt ein größeres Verständnis für die zugrunde liegenden philosophischen und historischen Fragen auf diesem Gebiet, als die meisten meiner Kollegen an den Tag legen".
Aus der Suche nach einer Diagnose und einer Ursache für ihr krankhaftes Zittern - bis zum Schluss blieben sie unauffindbar! - wurde immer mehr ein sich weitendes Verständnis ihres eigenen Selbst, bis sie zum Schluss "die zitternde Frau" als Bestandteil ihrer Identität annehmen und zustimmen kann:
"Die Geschichte der zitternden Frau ist die Erzählung von einem sich wiederholenden Ereignis, das im Laufe der Zeit, aus immer anderen Perspektiven gesehen, vielfältige Bedeutungen gewonnen hat. Was zuerst als ein Ausreißer erschien, wurde nach seiner Wiederkehr beängstigend und emotionsbeladen" (S. 200).
"[Ich] habe mich viel schwerer getan, die zitternde Frau in meine Geschichte zu integrieren, aber je vertrauter sie mir wird, umso mehr geht sie von der dritten Person in die erste über, kein gehasstes Double mehr, sondern ein zugegebenermaßen behinderter Teil meines Selbst" (S. 209).
"Ich bin die zitternde Frau" (S. 218 - der Schlusssatz des Buches).
Robert C. Ware 
Februar
2017
Und eine weitere Rezension:
Psychoanalyse als theoretische Eigenanalyse ist nicht möglich. Bemerkungen zu »Die zitternde Frau« von Siri Hustvedt.
»Der Mensch ist gegen sich selbst, gegen Auskundschaftung und Belagerung durch sich selber sehr gut verteidigt, er vermag gewöhnlich nicht mehr von sich als seine Außenwerke wahrzunehmen. Die eigentliche Festung ist ihm unzugänglich, selbst unsichtbar, es sei denn, daß Freunde und Feinde die Verräter machen und ihn selber auf geheimem Wege hineinführen.«1
Es ist ein merkwürdiges Buch, eine Mischung aus Literatur und Sachbuch. Anfangs machte es mich neugierig, dann ließ nach den ersten zwanzig Seiten das Interesse nach, um schließlich wieder neu aufzuflammen. Nun, das Nachlassen des Interesses stand in Zusammenhang mit der Erwartung einer eher psychoanalytischen Reise auf hohem literarischen Niveau. Schließlich ist die Autorin eine renommierte Schriftstellerin mit vielen Auszeichnungen. Und wie oft habe ich schon bedauert, dass Fachliteratur so wenig literarisch ist, wie dies noch bei Freud der Fall war, der sich selbst darüber verwunderte, dass seine Fallberichte sich eher wie Novellen lesen. Daran knüpft Hustvedt im Grunde an – nur vermeidet sie die Psychoanalyse, bzw. interessiert sich für sie aus einer Perspektive des Studiums Freudscher Texte, ohne wirklich in eine Eigenanalyse einzutreten. Und so bewahrheitet sich einmal mehr, dass Psychoanalyse ohne ein lebendiges Du nicht gut gelingen kann, es bleibt theoretisches Reden unter Wirkung der Abwehrmechanismen. Selbst dies ist ja der Autorin intellektuell klar: »Ein ›Ich‹ existiert nur im Verhältnis zum ›Du‹. Sprache findet zwischen Menschen statt« (S. 64).
Dass mein Interesse wiederkehrte hängt mit dem profunden Wissen der Autorin zusammen, die sich sowohl in der Hirnforschung, der Neuropsychologie und -psychoanalyse (fragwürdige Titel allerdings) und der Philosophie auskennt und erzählerisch komplexe Zusammenhänge vermittelt. Sie verführt gleichsam in die intellektuelle Welt und lenkt zugleich von den wirklich persönlichen Aspekten ihrer Erkrankung ab. Immerhin hat sie ein Narrativ für sich gefunden und auch zu einer Integration und Akzeptanz des Zitterns – vor einer Psychoanalyse als Analysandin weicht sie jedoch aus, wobei ihr eine Psychiaterin und Psychoanalytikerin sogar in der Abwehr behilflich ist, indem diese sie vorschnell auf die neurologische Schiene setzt und ins MRT schickt. Hier bewahrheitet sich eine Bemerkung Freuds gegenüber Viktor von Weizsäcker in einem Brief: Es sei notwendig gewesen, »›die Analytiker aus erziehlichen Gründen‹ von der medizinischen Neurologie« fernzuhalten, »denn Innervationen, Gefäßerweiterung, Nervenbahnen wären zu gefährliche Versuchungen für sie gewesen, sie hatten zu lernen, sich auf psychologische Denkweisen zu beschränken« (Weizsäcker, 1947, VI, S. 122, zit. n. Meyer-Abich, 2010, S. 187). Im MRT war nichts zu finden, aber im Anschluss hat Hustvedt einen heftigen Migräneanfall und der zaghafte Ansatz, zu einer möglichen Psychoanalyse mit einem realen Gegenüber, wird im Keim erstickt.
Bevor ich mich an das Wagnis einer ungefragten Analyse machen konnte, musste ich zunächst eigene Widerstände überwinden. Darf man das überhaupt tun? Frau Hustvedt ist eine kluge und eloquente Autorin, die inzwischen auch ein paar Ehrendoktorhüte erhalten hat. Und hat sie nicht mit vielen kompetenteren Psychoanalytikern gesprochen, ist doch sogar mit einem befreundet, der ihr die oben erwähnte Psychiaterin vermittelt hat? Ich streife mal diese moralischen Überlegungen ab und mute der Autorin das Risiko zu, dass sie mit ihrer durchaus mutigen Veröffentlichung eingegangen ist.
Ein anderer Aspekt, der mir zugänglich ist, hat mit einem Ärger zu tun. Der besteht darin, dass die Autorin zwar durchaus anerkennend und wohlwollend psychoanalytische Aspekte einbezieht (Freud, Winnicott), dann aber doch weiter dem Abwehrmechanismus der Intellektualisierung folgt – was sie zum Ende ihres Buches sogar unbewusst konstatiert, wenn sie sich auf Anna Freud bezieht (S. 216). Es ist ihr auch wichtig zu erwähnen, dass sie nach einer öffentlichen Lesung fürchtete, zwei auf sie zukommende Psychoanalytiker könnten ihr eine Analyse offerieren wollen – was denkbar taktlos gewesen wäre -; sie hatten denn auch nur ein paar Nachfragen.
Der Hype um die Hirnforschung führt unter anderem dazu, wieder weg zu kommen vom komplexen Erleben menschlicher Existenz und öffnet Tür und Tor für einen Reduktionismus naturwissenschaftlicher Provinienz. Dem sitzt die Autorin bewusst nicht auf, hat da eine äußerst differenzierte Haltung – jedoch vermeidet sie den entscheidenden Schritt, bleibt in der intellektuellen Reflexion (trotz oder gerade wegen der Anleihen in Psychoanalyse, Psychologie, Neurophysiologie und Philosophie).
Wie in einem Erstgespräch die ersten Sätze, kann man die ersten Zeilen eines Textes als Kernaussage betrachten, in der das zu bearbeitende Problem, der zentrale Konflikt bereits angesprochen ist: »Als mein Vater starb, war ich zu Hause in Brooklyn, hatte aber nur wenige Tage zuvor in einem Pflegeheim in Northfield, Minnesota, an seinem Bett gesessen« (S. 7). Wie gesagt, Frau Hustvedt ist sehr klug, sie vermutet auch, dass ihr Zittern irgendetwas mit ihrer Vaterbeziehung zu tun hat. Und es gibt einige Hinweise, aus denen sich ein mögliches Narrativ entwickeln lässt.
Die Symptomatik tritt erstmals auf, als Frau Hustvedt drei Jahre nach dem Tod ihres Vaters eine Laudatio auf ihn hält. Sie war dazu von dem College eingeladen worden, an dem ihr Vater 30 Jahre gelehrt hatte. Es wurde ihm zu Ehren ein Baum gepflanzt, an dessen Fuß eine Gedenktafel aufgestellt wurde. Hier begann seine Tochter ihre Rede zu halten. Sie öffnete den Mund zu ihrem ersten Satz »und begann vom Hals abwärts zu zittern. Meine Arme zuckten. Die Knie knickten ein. Ich zitterte so stark, als hätte ich einen Krampfanfall« (S. 9). Gleichwohl konnte sie weiter sprechen, denn die Stimme war nicht betroffen.
Leibanalytisch ist sofort daran zu denken, dass hier die Dominanz des Intellekts (überlicherweise im Kopf angesiedelt) beim ersten Auftreten des Symptoms noch die Kontrolle halten konnte, denn sie brachte ihre Rede unter großer Anstrengung zu ende. Jedoch sind Gefühle, die mit ihren beängstigenden auslösenden Empfindungen nicht im Kopf sitzen, sondern besonders den Bauchraum betreffen meist durch flache Atmung in Schach gehalten. Hier vermutlich durch Jahrzehnte langes »Training« durch den Intellekt gebannt, brechen sie nun hervor.
Wir finden auch einiges zum möglichen Konflikthintergrund im Text verstreut. Nach dem Tod des Vaters arbeitete Frau Hustvedt an einem Roman, für den sie die väterliche Erlaubnis zur Nutzung von dessen Erinnerungen erhalten hatte. Diese Arbeit unterbrach sie, um besagte Rede vorzubereiten. Thematisch war sie jedoch die ganze Zeit mit ihrem Vater und ihrer Beziehung zu ihm befasst. In diesem Roman stellt sie einen Psychiater und Psychoanalytiker dar, den sie mit der Zeit als ihren »imaginären Bruder« betrachtete. Er war »der Junge, der in der Familie Hustvedt nie geboren wurde« (S. 11). Dieser Ich-Erzähler kann als Alterego der Autorin aufgefasst werden. Zu Hause waren sie vier Schwestern und Siri Hustvedt war vermutlich in der Rolle des ersehnten Jungen und entsprechend war sie stark mit dem Vater identifiziert, hat unter anderem auch Literaturwissenschaften studiert, für die ihr Vater einen Lehrstuhl hatte. Als Hustvedt das erste Mal zitterte, befand sie sich »auf vertrautem Terrain. Nicht nur dass mein Vater viele Jahre an dem College gelehrt hatte. Ich selbst habe als Kind auf diesem Campus gewohnt« (S. 109). So fragt sie sich, ob das Zittern damit zu tun habe, »dass ich den Platz meines Vaters einnahm? Ganz buchstäblich, indem ich an einem Platz stand, der, wie ich spürte, ihm gehörte?« (S. 111)
Immer wieder kommt Frau Hustvedt auf das Thema der hysterischen Konversionsstörung zu sprechen und immer wieder scheint sie froh, dass ihr die Autoritäten bescheinigen, dass es sich nicht um eine solche Symptomatik handelt. Zurecht findet sie das Konversionsmodell auch nicht befriedigend. Zum einen ist die Hysterie aus der Mode gekommen, zum anderen greift die Vorstellung, ein psychischer Konflikt konvertiere in den Körper und ist somit aus dem Bewusstsein verdrängt, auf die Aufteilung der Existenz in Körper, Seele, Geist zurück, was aus heutiger Sicht nicht besonders befriedigend ist. Vielmehr ist von einem konflikthaften Geschehen die ganze Existenz ergriffen und Symptome, die sich am Leib zeigen, haben vermutlich Bezug zu einer leiblich-biologischen Disposition. Das entspricht dem Gedanken Alfred Adlers von der »Organminderwertigkeit«, worunter er Funktionsanomalien verstand, die durch genetisches Erbe, aber auch durch die »Lebensbewegung« (Heisterkamp) des Menschen erworben sein können.
Hier gibt es Ansätze in der Vorgeschichte. Die Fieberkrämpfe des Säuglings und eine seit Jahren bestehende Migräne mit Aura. Das kann als Disposition angesehen werden. Zur Migräne gibt es neben der Disposition die Erfahrung im Umgang mit Migränepatienten, dass sie ein erhöhtes Kontrollbedürfnis haben. Hier ist schon wieder Vorsicht geboten. Es gibt in der Analyse der Lebensbewegungen keine einfachen Wenn-Dann-Verknüpfungen. Anders als in der klassischen Physik gibt es hier keine »harten« Fakten und es gilt eine andere Maxime Adlers: Es kann alles auch ganz anders sein. Folgen wir der Hypothese, dann ist die Angst vor Kontrollverlust eine Spur, der wir nachgehen könnten. Und unsere imaginäre Patientin vermeidet es, sich in eine analytische Beziehung zu begeben, wo sie Kontrolle ab- und aufgeben müsste. Hier können wir einerseits eine Wechselwirkung annehmen, denn eine Migräneattacke ist nicht nur sehr schmerzhaft, sie schränkt auch stark ein. Da hat Frau Hustvedt allerdings gelernt mit umzugehen, findet Erleichterung in Biofeetbackmethoden, arbeitet auch mit Migräne und manchmal legt sie sich einfach hin. Die Angst vor Kontrollverlust wird aber noch durch eine andere Disposition gespeist, die aus einer äußerst starken Sensibilität stammt, die sich als weite Öffnung zur Umwelt zeigt, das heißt, das Reize aus dem Außen fast ungefiltert in sie eindringen. Ist der Durchschnittsmensch meist ziemlich verschlossen gegen äußere Reize, so der hochsensible weit geöffnet. In solcher Sensibilität wird auch von den Mitmenschen, überhaupt den Lebewesen unendlich viel wahrgenommen, was subtilste Eindrücke ermöglicht, die wir sonst bei Säuglingen kennen, die im koenästhetischen Fühlen Stimmungen und Befindlichkeiten der Mutter wahrnehmen, ehe sie selbst noch damit in Kontakt ist. Frau Hustvedt erwähnt zum Beispiel ihre »Mirro-touch- oder Berührungs-Synästhesie«. Bloße Beobachtung des Schmerzes eines anderen führt zur Schmerzempfindung bei ihr. Möglicherweise gibt es hier eine besonders entwickelte Aktivität der Spiegelneurone. Jedenfalls spürt sie
»den verstauchten Fuß von jemand anderem als Schmerz in meinem eigenen. Die Beobachtung, wie eine Mutter ihr Kind streichelt, vermittelt mir das körperliche Lustgefühl, das ich selbst als Mutter oder Kind bei solchen Liebkosungen empfinden würde. […] Gewaltszenen oder Horrorfilme sind mir unerträglich, weil ich die Qualen der Opfer fühle« (S. 130).
Die Angst vor Kontrollverlust speist sich unter anderem aus dieser Quelle, denn die Grenzen zu den anderen sind extrem durchlässig, was mit dem Gefühl des Verlustes des eigenen Selbst verbunden ist. Welche Bedeutung dem in der Identifikation mit dem Vater zukommt, ist an einer Szene abzulesen, die Frau Hustvedt aus der letzten Lebenswoche ihres Vaters schildert: In der Zeit war sie im elterlichen Haus und besuchte und versorgte zusammen mit ihrer Mutter den sterbenden Vater im Krankenhaus. In einer der letzten Nächte vor dem Tod des Vaters kroch sie in das viel zu enge und kurze Bett, in dem sie als Kind geschlafen hatte. Dort liegend und an den Vater denkend, fühlte sie »den Sauerstoffschlauch« in ihren Nasenlöchern,
»das Unangenehme daran, die Schwere meines lahmen Beins, aus dem vor Jahren ein Tumor entfernt worden war, den Druck meiner gepressten Lungen und eine panische Hilflosigkeit, ich würde mich nicht mehr aus diesem Bett in mein eigenes bewegen können und um Hilfe rufen müssen. Solange es dauerte […], war ich mein Vater« (S. 138).
Die Kunst in der Darstellung der Autorin zeigt sich unter anderem darin, dass wir bis zum letzten Halbsatz im Unklaren darüber sind, ob die Autorin einen Tumor im Bein hatte.
Die Angst vor Kontrollverlust speist sich oft aus Schamerlebnissen, die dann meist intensivst in der Erinnerung haften, Adler spricht hier von »Memento« als warnender Erinnerung, die den gefundenen »Lebensstil« (Adler) immer wieder neu sichern. Hustvedt erinnert, als Vierjährige ihrer zwölf Jahre alten und sehr bewunderten Cousine in einer Tischszene beistehen zu wollen, weil diese – aus ihr unverständlichen Gründen – plötzlich weinte. Sie rutschte von dem Stuhl herunter und ging zur Cousine, um ihr auf den Rücken zu klopfen, wie man es tut, wenn sich jemand verschluckt hat. »Die Erwachsenen fingen an zu lachen, und mich erfasste ein Gefühl glühender Beschämung. Die Erinnerung daran hat mich nie losgelassen« (S. 113f.). Diese Angst vor Beschämung mag sie auch bei der Laudatio für den Vater berührt haben, denn er »schrieb ausgezeichnete und oft sehr witzige Reden« (S. 9).
Mag sein, dass diese Unsicherheit in den Grenzen die Zurückhaltung speist, sich in eine psychoanalytische Arbeitsbeziehung einzulassen. Denn immer wieder, wenn sie im Text in die Nähe einer existenziellen Erkenntnis kommt, wechselt sie auf das Feld der distanzierenden Forschung. So erlebte sie denn weiterhin ihr Zittern als »vollkommen irrational« und es war mit den Momenten verbunden, in denen sie »dem prüfenden Blick der Öffentlichkeit ausgesetzt war«, wobei noch hinzu kommen musste, dass sie bei Lesungen etwa Passagen vortrug, die sich aus den verwandten Erinnerungen ihres Vaters speisten, denn sie war ja Öffentlichkeit gewohnt, kannte kein Lampenfieber.
Aus all diesen Vermutungen wird das Zittern recht gut nachvollziehbar, zumal es noch eine zentrale identifikatorische Grenzunsicherheit zum Vater gibt, die wir als transgenerationale Weitergabe eines unverarbeiteten Traumas kennen. Sie selbst vermutet, »dass meine schon immer starke Identifikation mit meinem Vater noch intensiver geworden war« (S. 139). Und zwar während der Arbeit an dem Roman, in dem sie traumatische Erinnerungen des Vaters verwandte, die er vermutlich nie integrieren konnte; sie »borgte« sich die Worte ihres Vaters, als er über den Mord an einem japanischen Offizier berichtete und von seinen flashbacks.
Die starke Identifikation mit dem Vater kann durch theoretische Erwägungen nicht aufgelöst werden. Vielleicht ist es bezeichnend, dass Frau Hustvedt – trotz intellektueller Beschäftigung mit der Psychoanalyse – nichts von den zentralen Essentials psychoanalytischen Arbeitens schreibt: In einer intensiven intersubjektiven Beziehung unter Nutzung von Übertragung und Gegenübertragung und leibfundiertem Spüren Erinnerungen mit intensivem Erleben in der Übertragungsbeziehung zu integrieren. Erst so wird daraus ein Narrativ, das Anfang, Mitte und Ende hat, so zu einer Erfahrung werden kann, die wirklich abgeschlossen ist und als vergangen erinnert werden kann.
Abschließend sei noch auf die Abstand haltende lebensstiltypische Haltung hingewiesen, wie sie sich in der leiblichen Erscheinung zeigt. Auf dem Cover ihres Buches ist sie als sehr attraktive, ansprechende Erscheinung wahrzunehmen. Sie wirkt apart, durchgeistigt, dabei kühl und verstandesbetont. Wache und kluge Augen schauen den Betrachter an. Sie erinnert mich an Lou Andreas-Salomé eine ebenso kluge und doch unnahbar wirkende Frau. Wir sehen auf dem Foto eine lässig auf den rechten Ellenbogen gestützte Frau, was jedoch als inszeniert anmutet. Dabei hält sie sich selbst, indem sie mit der linken die rechte Hand umfasst, fast umklammert. Mit aller Zurückhaltung: Ausdruck kann vieldeutig sein!
Ich hoffe, Frau Hustvedt verzeiht mir, dass ich sie ungefragt und ungebeten imaginär auf die analytische Couch oder gar die Matte eines leibfundiert arbeitenden Analytikers gelegt habe. Aber die tiefenpsychologisch-analytische Herangehensweise ist zu wertvoll und oft äußerst hilfreich, als dass sie lediglich zu einem intellektuellen, theoretischen Konstrukt eingedampft werden sollte.
Bernd Kuck
Oder in der nächstgelegenen
Buchhandlung! So landen die Steuereinnahmen zumindest in
"unserem" Steuersäckel, was theoretisch eine
Investition in Bildung und Erziehung ermöglichen würde.
In Bonn-Bad Godesberg z.B. in der
Parkbuchhandlung

Oder finden Sie hier eine Buchhandlung in Ihrer Nähe:
|