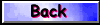Gabriel, Markus:
Ich ist nicht Gehirn. Philosophie des Geistes für das 21.
Jahrhundert. Ullstein Verlag, Berlin. 2015
Damit überhaupt ein Verständnis des
Geistigen jenseits einer naturalistischen Position, wonach alles
auf materielle Grundlagen zurück geführt werden könnte,
möglich ist, muss die Dichotomie eines naturwissenschaftlichen
Weltbildes auf der einen und einer geisteswissenschaftlichen
Betrachtung – die dann schnell zu einer Geister Betrachtung
herabgewürdigt wird, überwunden werden. Wissenschaft,
worunter heutzutage „Naturwissenschaft“ verstanden wird,
ist nicht notwendig identisch mit Aufklärung. Im vorliegenden
Text geht es nun darum, eine antinaturalistische Position zu
begründen, die in der Betrachtung unserer selbst als bewusste
Wesen eine lange Tradition in den Geisteswissenschaften hat. Und das
nicht nur im Abendland.
Der Untertitel erscheint etwas hoch gegriffen.
Allerdings ist er durchaus pragmatischer Natur, denn es geht Gabriel
ja darum, die Hochschätzung der Naturwissenschaften, die heute
gerne mit dem Anspruch des Alleinerklärungsrechtes auftritt
(Zeitalter des Gehirns), auf den Boden erkenntniskritischer Realität
zurück zu holen und damit zugleich in die Schranken zu weisen.
Die Phänomene des Geistes lassen sich nicht einfach auf
Materielles reduzieren, wenngleich sie einer materiellen Grundlage
bedürfen.
Gabriels Denken kommt selbstbewusst daher, verleugnet nicht die
Erklärungskraft geisteswissenschaftlicher Ansätze, wie sie
in begrifflichen Neuschöpfungen einer „Neurophilosophie“,
„Neuropsychoanalyse“, „Neurosoziologie“ oder
gar „Neurotheologie“ als Anbiederung an die
„In-Wissenschaft“ heute Mode geworden ist. Nicht etwa,
dass die Forschungsergebnisse der Hirnforschung in ihrer
Bedeutung für das menschliche Selbstverständnis reflektiert
werden, ist das Problem, sondern der fehlende kritische Abstand, der
die naturwissenschaftliche Perspektive auf die Welt zum neuen Götzen
erhebt. Auf der einen Seite werden hier Größen- und
Allmachtsphantasien mit neuer Nahrung versehen und auf der anderen
Seite die materialistische Weltsicht wieder einmal dazu benutzt, der
Anstrengung der Freiheit zu entkommen. Mein Gehirn ist als der neue
Schuldige gefunden. Die Überschätzung der Erkenntnisse der
Neurobiologie und der Evolutionsbiologie liefert die Grundlage für
Entlastungsphantasien, ist es doch so anstrengend, selbst
Entscheidungen treffen und auch noch die Verantwortung dafür
übernehmen zu müssen.
Gabriel
vertritt einen "Neo-Existenzialismus" in der Tradition von
Camus und Sartre. Danach ist der Mensch insofern frei, als er
sich ein Bild seiner selbst schaffen muss, "um überhaupt
jemand zu sein" (31).
Wir müssen uns selber deuten, um überhaupt eine Vorstellung davon zu haben, was wir tun sollen. Dabei entwickeln wir unvermeidlich Werte als Orientierungspunkte. Diese machen uns weder unfrei noch dogmatisch, wie man meinen könnte.
Deshalb muss sich der Mensch nicht den anderen Lebensformen überlegen dünken. Im vorliegenden Text geht es "zunächst einmal nur darum, den Raum unserer geistigen Freiheit auszuleuchten, anstatt an seiner Verdunklung durch die Marginalisierung der Geisteswissenschaften in der Öffentlichkeit demokratischer Gesellschaften weiterzuarbeiten".
"Neuromanie" und "Darwinitis" nannte der britische Mediziner Raymond Tallis (*1946) die Annahme, man könnte menschliches Verhalten aus der Neurophysiologie unseres Gehirns oder unserem evolutionären Erbe restlos erklären.
Es gibt eine Wechselwirkung zwischen der geistigen Welt und unserem Gehirn, die von den Hirnforschern durchaus nicht bestritten wird (z.B. Gerhard Roth). Es ist ja auch ein Verdienst der modernen Hirnforschung nachgewiesen zu haben, dass gerade das menschliche Gehirn eine wesentliche Plastizität aufweist, die überhaupt die Lernfähigkeit des Menschen ermöglicht. Diese Perspektive kommt nun im vorliegenden Text zu kurz, denn nicht alle Aussagen von Seiten der Neurobiologen sind so einseitig wie die des Evolutionsbiologen Richard Dawkins, gegen die Gabriel u.a. Position bezieht. Aber Gabriel nimmt implizit den Blick auf das Gehirn als sich selbst erzeugendes System auf, wenn er deutlich macht, dass wir eben eine Geistesgeschichte haben, die ihren Niederschlag in unseren Gehirnen findet und es ist dieser Aspekt, der mit naturwissenschaftlichen Methoden eben nicht befriedigend erhellt werden kann.
So, wie mancherorts die Erkenntnisse der Hirnforschung interpretiert werden – auch das wird leicht vergessen, dass auch in den Naturwissenschaften interpretiert wird -, leugnet man quasi die gesamte philosophische Tradition von Platon bis Sartre und darüber hinaus. Wenn in der sogenannten philosophy of mind die Philosophie des Geistes auf das Bewusstseinsphänomen reduziert und nunmehr nur noch danach gefragt wird, "wie das subjektive Phänomen eines mentalen Innenlebens in die anonyme, blinde, unbewusste und absichtslose Natur passt, deren Regelmäßigkeiten sich naturwissenschaftlich beschreiben lassen" (57f), dann ist die Frage nach dem Geistigen bereits verfehlt, da ein obsoletes naturwissenschaftliches Weltbild als Prämissenrahmen festgelegt wurde. Obsolet, weil inzwischen von der Quantenphysik in Frage gestellt.
Schon die Rede von „Repräsentanzen“ im Gehirn greift die alte Homunkulus-Vorstellung wieder auf, wonach quasi ein Ich im Gehirn sitzt oder doch bestimmte Gehirnareale dieses Ich repräsentieren, dass dann aber wieder verneint wird, weil es doch im Gehirn nicht gefunden werden kann, dieses Ich uns nur vorgegaukelt wird, wie alles, was wir in der äußeren Realität wahrnehmen.
Es wäre ein Widerspruch einerseits zu meinen, dass wir stets nur Bewusstsein von etwas auf unserem eigenen Bildschirm erlangen können, und andererseits davon auszugehen, dass wir genau dies aber nur dadurch wissen, dass wir Bewusstsein von etwas erlangt haben, das nicht auf unserem eigenen Bildschirm auftaucht (84f).
Gabriel erläutert für den philosophischen Laien einige Begriffe, die hilfreich sind, um die Komplexität der Frage nach dem Ich oder dem Geistigen zu untersuchen. Und schnell wird deutlich, dass die naturwissenschaftliche Betrachtung eben auch nur eine Perspektive ist und zwar die des Außen. Sie gehört damit dem intentionalen Bewusstsein an, indes wir über die innere Zuständlichkeit nur etwas Sinnvolles durch das phänomenale Bewusstsein erfahren. Letzteres ist zwar aus dem evolutionären Prozess entstanden; jedoch ist das Geistige als Ganzes kein evolutionäres Phänomen.
'Geist' und 'Bewusstsein' sind nicht dasselbe und daher deckt die Neurobiologie auch nicht komplett die Erforschung des Geistes ab, da sie nur einige notwendige Bedingungen für das Vorliegen von Bewusstsein in den Fokus nimmt (128).
Und so bedarf es der sinnvollen Zusammenschau der intentionalen und der phänomenalen Bewusstseinsperspektive. Verabsolutierung jeweils einer Seite führt zum „Bewusstseins-Rationalismus“ oder zum „Bewusstseins-Empirismus“, wie Gabriel es nennt. Beide Betrachtungsweisen sind Extreme, aber „beide Irrtümer tauchen bei verschiedenen Spielarten des Neurozentrismus auf“ (134).
Und was bitte ist das Ich? Aus der philosophischen Tradition greift Gabriel zwei Auffassungen heraus. Nach der „Bündeltheorie“ ist das Ich die Summe unserer Bewusstseinszustände (solche des Denkens, Fühlens und Handelns). Die „Substanztheorie“ hingegen geht davon aus, das Ich sei eine Instanz, der die genannten Zustände erscheinen. Dann wäre das Ich eine Substanz, ein Träger von Eigenschaften und damit nicht bloß eine zuständliche Form des Seins, sondern hätte einen wertenden Abstand zu diesen Zuständen. Von der Hirnforschung erhalten wir bei dieser Thematik keine Hilfe. Betrachtet man nämlich das Ich als von einer bestimmten Hirnregion erzeugt oder durch Synchronisation mehrerer Hirnregionen hervorgebracht, so drängt uns die Hirnforschung eher eine Substanz- als eine Bündeltheorie auf (205).
Am Beispiel der Pubertät macht Gabriel die Spielart des Neuroreduktionismus deutlich. Immer dann, wenn ein Phänomen mit den Mitteln der Neurowissenschaften nicht gut erklärbar ist, wird es auf ein neurowissenschaftlich erklärbares Phänomen reduziert. So wird dann die Pubertät allein aus den hormonellen Veränderungen in dieser Lebenszeit erklärt. Schon gefestigte neurologische Vernetzungen brechen noch einmal auf. Das ist aber nur die physiologische Seite. Die Inhalte der pubertären Rebellion sind damit noch nicht verstanden. Hier verfallen die Neurowissenschaftler dem „ontologischen Reduktionismus“ (209).
Der Neuroreduktionismus tritt traditionell großspurig auf, indem er beide, die ontologische Reduktion und die Theoriereduktion zugleich in Angriff nimmt (210).
Johann Gottlieb Fichtes (1762 – 1814) Wissenschaftslehre ist beim Verständnis der Aufteilung der Wissenschaftsmethoden in ihrer Zuständigkeit behilflich. Das Ich ist bei ihm alles, was etwas wissen kann, alles andere ist das Nicht-Ich. Damit handelte er uns allerdings das noch heute bestehende Dilemma ein, dass das Ich der Natur gänzlich entzogen wurde, was schon Goethe missfiel. Dies verführt noch heute die Neurowissenschaftler dazu, das Ich aus dem Weltbild zu streichen und alles Ich-Förmige in die Sprache der Neurochemie oder der Evolutionsbiologie zu übersetzen (227f).
Interessant ist auch die Differenzierung zwischen Wissen und Vorstellung. Wissen muss wahr sein, teilbar und wird es bezweifelt mit guten Gründen belegbar sein. Vorstellungen hingegen kann man zwar mitteilen aber nicht wirklich teilen, weil ich nie wissen kann, wie das Erleben des anderen wirklich ist. Damit hat also schon Fichte zu seiner Zeit dagegen protestiert, wir könnten etwas Wissen, weil wir Vorstellungen haben,
die in uns dadurch entstehen, dass die Nervenenden unserer Sinnesrezeptoren gereizt werden (234).
Die Psychoanalyse wird in ihren Auswirkungen auf die Entwicklung unseres Geistes ebenfalls gewürdigt, wenngleich Gabriel das „szientistische Selbstmissverständnis“ kritisiert, ohne dabei Habermas zu erwähnen, der dies schon verdeutlicht hat. Die Versuche Freuds „Entwurf einer Psychologie“ (1895) als Beleg für eine naturwissenschaftliche Grundlage der Psychoanalyse zu reklamieren (dies tut z. B. Allen Schore, „Affektregulation und die Reorganisation des Selbst“, Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2007), weil Freud darin eine „Neuronentheorie“ skizziert, weist Gabriel zurück. Zwar hat Freud nie die Hoffnung aufgegeben, die Psychoanalyse könnte eines Tages eine naturwissenschaftliche Grundlage erhalten, faktisch jedoch hat er den Weg der Neurologie verlassen. Freud habe
gerade zur Psychoanalyse gefunden, weil er verstanden hat, dass es Strukturen unseres geistigen Lebens gibt, die sich in der Art und Weise manifestieren, wie wir uns selbst und unsere Einstellungen zu Anderen beschreiben (240).
Freuds Strukturmodell (Ich, Es, Über-Ich) findet Gabriel wenig stringent und es erinnert ihn eher an Pippi Langstrumpf, die sich die Welt macht, wie sie ihr gefällt. Ließe sich die Frage Gabriels, „was soll es heißen, dass das Ich ein Anteil des Es ist?“ (253) dahingehend beantworten, dass für Freud eben das Ich 'das Auge der Welt' ist, durch dass sich die Welt ihrer selbst bewusst wird? Und es sind eben die kulturell- und erziehungsbedingten Einflüsse, die aus dem großen Pool des Ubw. nur Anteile bewusst werden lassen, weshalb eben das Es nie ganz im Ich aufgehen kann, das Ich Teil des Es bleibt. Und das Ich kann durchaus selbst unbewusst und triebhaft sein, etwa weil bestimmte Wünsche dem Ich wohl gefallen, aber von Bewertungen aus der Moral verworfen, jedoch keineswegs aufgegeben werden. Das Ich kann durchaus für die Wahrnehmungen zuständig bleiben. Werden etwa beide Tendenzen, also Wünsche und moralische Forderungen, wahrgenommen, so entsteht der innere Konflikt, dessen neurotische Lösung z.B. die Symptombildung darstellt. Außerdem bleibt immer noch die Zuflucht zur Lüge oder zum Fabulieren, was Gabriel im Grunde weiter unten der aktuellen Darwinitis vorwirft.
Gabriel anerkennt durchaus Freuds Leistung und was seine Gedanken schließlich zur kulturellen Entwicklung und Emanzipation des Menschen beigetragen haben. Er möchte aber die postulierte biologische Grundlage von Freuds Theorie hinterfragen (neben anderen problematischen Behauptungen der PA). Kritisch angemerkt sei allerdings, dass Freud schon lange nicht mehr die Psychoanalyse ist. Dennoch hat Freud zur Mythenbildung beigetragen, wo ihm Tatsachen fehlten, hat er die Phantasie walten lassen, sowohl in der individuellen als auch in der kollektiven Geisteswelt. Auch in der heutigen „Darwinitis“ erkennt Gabriel diese Strukturen, die man doch schon für überwunden glaubte.
Anstatt die Frage zu stellen, wer oder was das Ich eigentlich ist, und eine kohärente Antwort darauf zu entwickeln, die auch historisch darüber informiert ist, welche Selbstbeschreibung die Rede vom Ich mit sich führt, wird eine in Wirklichkeit nicht erkennbare Vergangenheit beschworen. Diese muss zeitlich weit genug zurückliegen und nur durch ein paar Schädelfunde, vielleicht auch durch eine Speerspitze, allenfalls durch ein Höhlengemälde belegt sein. Denn dann kann man ziemlich beliebige Geschichten darüber erzählen, wie wir aus dieser Vergangenheit abstammen.
Genau das ist Mythologie. Die politische Hauptfunktion der Mythologie besteht darin, sich eine Vorstellung von der gesamtgesellschaftlichen Situation seiner eigenen Zeit zu machen, indem man sich eine Urzeit ausmalt. Je weniger man dabei wirklich über diese Vergangenheit weiß, desto erfinderischer kann man sein“ (257).
Das Ich wird in der Interaktion mit anderen, die Träger der aktuellen und historischen Werte sind. Das wird sich dann auch irgendwie in Gehirnstrukturen abbilden. Die Gedanken und Werthaltungen werden wir darin aber nicht substanzialisiert finden.
Vielmehr ist es so, dass wir ohne Gehirne einer bestimmten Art niemals dazu gekommen wären, die Dimension des Ichs historisch auszubilden. Gehirne sind eine notwendige Bedingung dafür, dass es die Praktiken gibt, in die Ich involviert sind. Doch die Entdeckung des Ichs erfolgt im Rahmen historischer Prozesse der Selbsterkenntnis (260f).
Die Verwechslung der notwendigen naturalistischen Bedingungen (ein bestimmtes Gehirn) mit den gewordenen geistigen Leistungen der Selbstbeschreibung, bildet die Grundlage von Ideologien, hinter denen immer wieder der Versuch aufscheint, sich der Freiheit zu entledigen und zu einem möglichst unverantwortlichen Ding zu werden.
Spannend ist auch Gabriels Argumentation bezüglich unseres Freiheitserlebens. Den Willen negiert er, damit auch die Debatte um die Willensfreiheit. Unsere Freiheit besteht vielmehr in der Handlungsfreiheit und damit bietet Gabriel einen Lösungsansatz für den Streit der Deterministen mit den Indeterministen. Gabriel greift dazu auf Leibniz' Satz vom zureichenden Grund zurück. Und so finden wir unsere Freiheit in der Handlungsfreiheit, die in den notwendigen Gründen zu suchen ist. Ein Ereignis findet nach Gabriel statt, wenn notwendige Bedingungen, zu denen „harte Tatsachen“ und selbst gesetzte Gründe gehören, zusammengenommen hinreichend sind. Dabei können mich „harte Tatsachen“, wie Naturgesetze sie beschreiben, zwingen, Gründe können dies nicht. Dabei bleibt es schwierig zu entscheiden, wann neuronale Verhältnisse des Gehirns zwingend sind. Süchte dürften dazu gehören, ebenso wie veränderte Hirnstrukturen aufgrund von fortgesetzten Traumatisierungen in früher Kindheit. Hier wird es dann schnell ideologisch. Das können wir so hinnehmen und dies zu „harten Tatsachen“ erklären. Wir könnten aber auch die Ursachen zukünftig beseitigen (etwa Kriege in der Welt oder in den Familien), was gewaltige Anstrengungen zur Aufhebung „selbst verschuldeter Unmündigkeit“ (Kant) notwendig machte. Genauso könnten wir die enorme Plastizität des Gehirns in Rechnung stellen und Behandlungsmethoden entwickeln, die zumindest das individuelle Leid beheben. Das tut z.B. Karl Heinz Brisch in München in der Behandlung von komplex traumatisierten Kindern und Jugendlichen. Das setzt allerdings voraus, dass der Betreuungsschlüssel für diese Kinder stimmt. Dann lässt sich auch im Hirnscanner nachweisen, dass bestimmte Hirnareale an Wachstum zulegen, ohne dass wir dann mit neurowissenschaftlichen Methoden zeigen könnten, was da inhaltlich genau geschieht.
Es bleibt also spannend und in den Geisteswissenschaften ist viel zu holen, was uns dem Verständnis des Menschlichen näher bringt, was vor allem die Naturwissenschaften nicht zu leisten im Stande sind.
Bernd Kuck 
Dezember
2015
-
|

|
Oder in der nächstgelegenen
Buchhandlung! So landen die Steuereinnahmen zumindest in
"unserem" Steuersäckel, was theoretisch eine
Investition in Bildung und Erziehung ermöglichen würde.
In Bonn-Bad Godesberg z.B. in der
Parkbuchhandlung

|