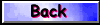Fuchs Thomas: Verteidigung des Menschen. Grundfragen einer verkörperten Anthropologie. 331 Seiten, 4. Auflage, Berlin 2022: Suhrkamp TB Wissenschaft
Thomas Fuchs ist bekannt mit seinem grundlegenden Werk „Das Gehirn – ein Beziehungsorgan“ (2008). Der Phänomenologe, Inhaber des Karl-Jaspers-Lehrstuhls in Heidelberg, legt hier eine Textsammlung verschiedener Veröffentlichungen vor. Bislang unveröffentlicht sind die beiden ersten Texte (Menschliche und künstliche Intelligenz. Eine Klarstellung; Jenseits des Menschen? Kritik des Transhumanismus), in denen er sich zu aktuellen Themen positioniert.
In gewohnt differenzierter Weise redet er der Menschlichkeit das Wort, wendet sich »gegen die Herrschaft technokratischer Systeme und Sachzwänge ebenso wie gegen die Selbstverdinglichung und Technisierung des Menschen« (S. 16). Dass sich im Zuge der auf allen Seiten vorangetriebenen Digitalisierung die Welt auf Daten reduziert, ist ihm ein Dorn im Auge. Besonders der unkritische Umgang damit. So geht der Welt und dem Menschen Wesentliches verloren: das Lebendige.
Karl-Heinz Dürr wies darauf hin, dass bei der Musik auf technischen Medien zwar Daten und Informationen transportiert werden, das Wesentliche aber nur durch den Menschen gehört werden kann. Ebenso macht Fuchs deutlich, dass der Ausruf Fausts in Gretchens Zimmer: »Wie atmet rings Gefühl der Stille, der Ordnung, der Zufriedenheit!« sich nicht in definierte Einzeldaten auflösen, geschweige denn digitalisieren lässt. Eine künstliche Dummheit (KI) wird das Atmosphärische eines zwischenmenschlichen Dialoges nicht erfassen können. Sogenannte „künstliche Intelligenz“ ist bereits ein falscher Begriff. Intelligenz leitet sich vom Lateinischen „intellegere“ ab und bedeutet »einsehen, verstehen, begreifen« (S. 43). Davon ist aber ein Algorithmus weit entfernt. Voraussetzung dazu wäre eine »exzentrische Positionalität« (Plessner), ein Heraustreten aus dem eigenen Mittelpunkt. Und selbst wenn die Maschine irgendwann in allen denkbaren Situationen eine zutreffende, gar perfekte Antwort geben kann, fehlt ihr doch das Selbstbewusstsein, was eine weitere Voraussetzung für Intelligenz ist.
[Aktuell beginnen sich die KI Algorithmen selbst ad absurdum zu führen, da sie wechselseitig Unsinniges sammeln und wiedergeben, und dann wieder an den KI generierten Texten trainiert werden („Kollaps droht wegen KI-generierter Trainingsdaten“, https://www.heise.de/news/KI-Kollaps-droht-wegen-KI-generierter-Trainingsdaten-9823352.html?wt_mc=nl.red.ho.ho-nl-daily.2024-08-05.ansprache.ansprache; Zugriff: 5.8.2024, 12:16)].
Ebenso kritisch sieht Fuchs die Positionen des Transhumanismus, deren Vertreter es sich zur Forderung gemacht haben, den Menschen zu ‚verbessern‘, sein Geschlecht, sein Aussehen, seine Intelligenz seinen Wünschen entsprechend zu verändern. Die Idee, den Menschen durch Eingriffe von außen zu vervollkommnen, wird schnell ad absurdum geführt. So zeigt sich etwa, dass »die Oxytocin-Einwirkung [..] dazu [führt, dass] Mitglieder der eigenen Gruppe gegenüber Fremden« bevorzugt werden, ja sogar »Vorurteile und Xenophobie« begünstigt werden (De Dreu et al. 2010, 2011) (S. 91).
Der Kern des Bewusstseins, wodurch wir erst zu fühlenden und wollenden Wesen werden, wird durch die Reduktion auf Informationen nicht erfasst. Niemals findet sich im Gehirn ein individuelles Erleben von Schmerz. Überhaupt stellt es eine Illusion dar, anzunehmen, dass sich die Gesamtheit unserer leiblichen und damit biologischen Existenz informationstheoretisch erfassen ließe. Immer ist es der Mensch, der denkt und handelt, nicht das Gehirn (S. 108). Mit einer derartigen Betrachtungsweise, die letztlich reduktionistisch ist und dem alten dualistischen Denken verhaftet bleibt, dem Wahn des Machbaren, der Unterwerfung alles Lebendigen unter den Anspruch, dem Menschen Zweck zu sein, geht letztlich eine Verachtung des Lebendigen einher.
»Das Phantasma der Verschmelzung von Geist und Technik ist Ausdruck einer untergründigen Missachtung, ja Verachtung des Lebens und des lebendigen Leibes« (S. 109).
Schon verschiedentlich ist die Frage aufgeworfen worden, ob nicht die Überwertigkeit digitaler Anwendungen, speziell die Durchdringung des gesellschaftlichen Lebens durch sogenannte soziale Medien, zu einer Verflachung menschlichen Seins und Erlebens führen. Fuchs verdeutlicht, dass die Gemeinsamkeit medialer und virtueller Welt darin besteht, dass sie uns von der unmittelbaren leiblichen Erfahrung abtrennen, zu einer »Entkörperung« führen. Nicht genug, folgt ebenfalls ein Verlust der Empathie. Durch die Flutung mit Nachrichten aus aller Welt, die uns nicht wirklich betreffen, ereignet sich eine Abstumpfung. »Die Gelegenheiten zur Empathie vervielfältigen sich, doch in gleichem Maß verflacht die Empathie selbst. Resultat dieser Entwicklung ist das, was Anders den „medialen Idealismus“ nannte: Die Welt wird zum Schauspiel, der Zuschauer zum passiven Konsumenten der Vorstellungen, die die Medien ihm liefern ...« (S. 134).
In diesem Kontext ist der Hype um die Spiegelneuronen kritisch zu hinterfragen, wodurch die zwischenleibliche Empathie auf Simulation reduziert wurde. Neuronale Spiegelsysteme sollen bei der Wahrnehmung des anderen eigenleibliche Empfindungen hervorrufen, die dem wahrgenommenen Ausdruck des anderen entsprechen.
»Tatsächlich besteht hier aber gar kein „Als-ob“, denn die eigenen Leibempfindungen und Bewegungsanmutungen, die in der Begegnung mit dem anderen mitschwingen, gehen nur implizit in die Wahrnehmung seines Ausdrucks ein« (S. 125).
Das ist die Simplifizierung menschlicher Interaktionen und widerspricht den Phänomenen. So löst z.B. ein zorniges Gegenüber nicht Zorn im Betrachter aus, sondern Angst und Schrecken.
Der Hype um die Interaktion via Online-Medien führt ebenso zu einer Reduzierung sozialer Fähigkeiten. Die ansonsten intime Begegnung verkommt zum Online-Dating oder gar zur Online-Psychotherapie, die den Gang zu Therapeut:innen ablösen soll. Die Telekommunikation vervielfacht und beschleunigt zwar die Kontaktmöglichkeiten, »doch ohne reale Begegnung fehlt ihnen die Authentizität der zwischenleiblichen Resonanz« (S. 136). Dies zeigte etwa eine Metaanalyse von 72 Studien zwischen 1979 und 2009, wonach die Empathiefähigkeit von amerikanischen College-Studenten um 40% abgenommen hat. Einen Hauptabfall gab es im Jahr 2000, was die Autoren mit der Zunahme der Nutzung digitaler Medien und virtueller Interaktionen in Beziehung setzen.
»Wenn alles wirkliche menschliche Leben Begegnung ist, wie Martin Buber (1984: 15) schreibt, dann entscheidet sich an der Frage, ob und in welcher Weise wir einander begegnen, unser Verhältnis zur Wirklichkeit überhaupt« (S. 141).
Die grundsätzliche Tatsache, dass der einzelne Mensch immer schon in ein Mit-sein hineingeboren wird, macht deutlich, dass unsere Wahrnehmungen niemals die eines Subjektes gegenüber seiner Welt ist, sondern bereits die mögliche Gegenwart und Perspektive anderer enthält. Wäre unsere Wahrnehmung eine bloße Konstruktion durch neuronale Aktivitäten in unserem Gehirn (wie die Konstruktivisten behaupten), dann könnten wir niemals gemeinsam den selben Gegenstand betrachten. Bereits beim Erwerb der Sprache erwirbt das Kind die implizite Intersubjektivität, sind die anderen immer schon präsent. Dies wiederum hat Auswirkungen auf unsere Wahrnehmung, kann z.B. durch Erkrankung an Schizophrenie verloren gehen.
»In der Schizophrenie kann also das wahrnehmende In-der-Welt-Sein, nämlich die implizite Intersubjektivität und damit Objektivität der Wahrnehmung, verloren gehen. Die Patienten werden dann gewissermaßen unfreiwillig zu „subjektiven Idealisten“, ja zu Solipsisten, die in ihre defizienten Wahrnehmungen wie in eine Eigenwelt eingeschlossen bleiben« (S. 167).
Ähnliches geschieht in den a-sozialen Medien, wo Gleichgesinnte in ihrer Blase Verschwörungstheorien anhängen und Hass verbreiten.
Der Zerebrozentrismus führt mehr und mehr zu einem Verlust menschlicher Personalität. Sprachlich zeigt sich dies etwa darin, dass behauptet wird, Amygdala oder irgend eine andere Struktur im Gehirn würde entscheiden. Das Gehirn ist aber nur ein Organ unter anderen, vor allem ist es nicht der Sitz der Person, sondern ein Organ der Person; »Personalität bedeutet verkörperte Subjektivität« (S. 181). Daher entscheidet kein Organ, sondern immer die Person in ihrer ganzen Leiblichkeit. Der gesamte Leib ist Träger der individuellen Biographie. Daher ist es möglich, einen mir bekannten Menschen an seinem Gang zu erkennen. Gewohnheiten sind eingeleibte Bewegungsmuster, die charakteristisch für das Individuum sind. Immer aber ist es der gewordene ganze Leib, der zur gewordenen Persönlichkeit gehört. Die Neurowissenschaften reduzieren die Existenz auf ein Computermodell, in dem Lebensbewegungen zu bloßen Rechenoperationen verkommen.
An unseren Stimmungen und Gefühlen ist unser gesamter Organismus beteiligt. Nahezu alle Subsysteme sind involviert. Keine Angst ohne erhöhten Herzschlag, größere Aktivität des sympathischen Nervensystems, Enge Empfindung in der Brust, Anspannung der Muskulatur, Veränderung des mimischen Ausdrucks. Entsprechendes gilt für andere Emotionen, wie auch in der Freude der ganze Leib freudig erregt ist.
Gegen die Parzellierung des Leibes in isolierte Organe oder Funktionen hat schon von Uexküll einen „Funktionskreis“ oder von Weizsäcker seinen „Gestaltkreis“ postuliert. Fuchs schließt daran an, wenn er den Menschen in rückgekoppelte Kreisprozesse eingebettet sieht. In diesen durchlaufenden Interaktionen verändert sich der Organismus. Darin gibt es gleichwohl Kausalitäten, die Fuchs in dem Begriff der »zirkulären Kausalität des Lebendigen« zu fassen sucht. Dies ist nicht gleichbedeutend mit strenger Determiniertheit, wie die naturwissenschaftliche Betrachtungsweise nahelegt, die immer noch davon ausgeht, wir könnten exakte Voraussagen treffen, wenn wir nur alle Elemente der Kausalkette kennen würden.
Ein Gedankengang soll zum Abschluss der Besprechung dieses wichtigen Textes noch angeführt werden. Fuchs macht die Abkopplung unserer technizistischen Welt von den Bedürfnissen des Leibes transparent. So beschreibt er den Unterschied zwischen der linearen Zeit der Moderne und der zyklischen Zeit des Leibes.
»Die Geschwindigkeit des Lebendigen wird abgelöst von der beliebig steigerbaren Geschwindigkeit des Unbelebten, nämlich der Daten, Bilder und Finanzströme, für die es im Grunde keine Entfernungen, keine Verzögerungen mehr gibt« (S. 310).
Damit einher geht der Verlust des »Spürbewusstseins« (Schellenbaum), dem Verlust der Wahrnehmung basaler Bedürfnisse des Leibes. Erschöpfungssignale werden ignoriert und führen immer häufiger zu Erschöpfungsdepressionen. In der Manie z.B. beschleunigt sich die Lebensbewegung, wird die zyklische Zeit ganz der linearen geopfert, gibt es keinen Tag- und Nachtrhythmus, keinen Raum für genussvolle Nahrungsaufnahme, bis dann die physische Erschöpfung den Zusammenbruch in der Depression erzwingt. Diese Fehlentwicklung bildet sich gesellschaftlich in der Dominanz der Ökonomisierung ab, wenn Geschäfte bis zu 24 Stunden geöffnet sind, die permanente mediale Erreichbarkeit die zyklische Zeit des Menschen und seiner Leiblichkeit beeinträchtigt oder sogar zerstört.
Bernd Kuck 
August
2024
|

|
Oder in der nächstgelegenen
Buchhandlung! So landen die Steuereinnahmen zumindest in
"unserem" Steuersäckel, was theoretisch eine
Investition in Bildung und Erziehung ermöglichen würde.
In Bonn-Bad Godesberg z.B. in der
Parkbuchhandlung

Oder finden Sie hier eine Buchhandlung in
Ihrer Nähe:
Buchhandlung finden
|