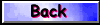Dürr, Hans-Peter: Warum es ums Ganze geht.
Neues Denken für eine Welt im Umbruch. Fischer Verlag
Frankfurt/M., 4. Auflage 2014, 189 S.
Hans-Peter Dürr, der Quantenphysiker und Träger des
Alternativen Nobelpreises verstarb am 18. Mai 2014 im Alter von 85
Jahren. Der vorliegende Text erschien bereits 2009 und hier fasst
dieser Querdenker seine wichtigsten Gedanken - auch für Laien
verständlich - zusammen und gibt Einblick in seinen persönlichen Werdegang. Dabei ist nicht raus, ob hier von
Begreifen die Rede sein kann, denn die zentralen Überlegungen,
die unser Weltbild eigentlich schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts
hätten erschüttern können, entziehen sich der
Fassungsfähigkeit unseres Gehirns. Auch unsere Sprache lässt
uns dabei im Stich, die im eigentlichen Sinne eine alltagspraktische
ist. Die Zusammenhänge lassen sich in mathematischer Sprache
darstellen; in allgemein verständlicher Sprache können die
komplexen Zusammenhänge nur in Bildern und Metaphern zu einer
Annäherung führen. Wer von uns kann sich schon etwas unter
einem n-dimensionalen Raum vorstellen? Bei drei Dimensionen ist
Schluss und selbst wenn wir die Zeit dazu nehmen, sind auch das nur
Begrifflichkeiten aus der dem Menschen fassbaren Welt.
Auf jeden Fall mach Dürr deutlich, dass das alte
mechanistische physikalische Weltbild nur im Groben seine Gültigkeit
hat. Was wir für die Wirklichkeit der Materie halten, ist in der
Welt der Quantenphysik gleichsam die ständige Reproduktion
'einfallsloser', 'unkreativer' "Beziehungen der Formstruktur".
Im Grunde gibt es nur Geist. Aber dieser Geist "verkalkt"
und wird, wenn er verkalkt, Materie. Und wir nehmen in unserer
klassischen Vorstellung den Kalk, weil er "greifbar" ist,
ernster als das, was vorher da war, das Noch-nicht-Verkalkte, das
geistig Lebendige.
Es gibt nunmehr eine – auch
physikalisch verstehbare – Verbindung zwischen belebter und
unbelebter Natur. Sie werden nicht mehr als Teile oder Teilaspekte
der Wirklichkeit verstanden. Damit sind sie nicht mehr grundsätzlich
unterschiedlich. Sie werden als dynamisch stabile bzw. statisch
stabile Manifestationen oder „Artikulationen“, als
„geformte Teilhabende des Ganz-Einen“ aufgefasst. Mensch
und Natur stehen sich nicht mehr als getrennt gegenüber. Zwar
hat der Mensch als angebliche „Krone der Schöpfung“ insofern
eine Sonderstellung, als er aktiv und mit Plan seine Umgebung
verändern kann – aber der Mensch steht in keiner Weise
über der Natur. Vielmehr tanzt er auf der Spitze eines
Kartenhauses, ja er zieht sogar unten Karten aus dem Kartenhaus, denn
nach seiner Auffassung brauchen wir dieses Tierchen oder jene Pflanze
eigentlich nicht (S. 105). Tatsächlich kam vor Längerem in einem Radiofeature ein Mensch zu Wort, der die Existenzberechtigung von Bibern
anzweifelte. Ingritt Sachse (www.ingrittsachse.de/gedichte/gedi711.html) dichtete dazu:
zerstört liegen die burgen die
dämme
erschlagen am ufer die bewohner
ihnen das fell über die ohren das
fell. wozu
brauchen wir biber fragt einer
hat
waldfrevel begangen muss sterben
aus
kerbigem plattschwanz
kriechen die asseln. wozu
fragen sie
brauchen wir menschen und
kriechen breite ströme wie asphalt
über straßen und häuser und
kriechen. da liegt
unter aschgrauem tuch
begraben
formlose masse
mensch
In dieser
Welt gibt es keine Materieteilchen, die sich streng gegeneinander
abgrenzen lassen – obwohl uns dies so erscheint. Es gibt nur
noch kreative Prozesse, keine Entwicklung mehr in der Zeit. So wie
ein Elektron an einer Stelle erscheint und wieder in das Nichts
eingeht, dann eines an anderer Stelle erscheint und wir glauben, es
hätte sich von A nach B bewegt, so gibt es möglicherweise
ebenso in der Evolution keine zeitliche Abfolge. Es findet keine
Entwicklung in der Zeit statt („wie ein zerknülltes Papier
sich auswickelt“ [S. 105]), sondern die Welt ereignet sich in
jedem Moment neu, hat allerdings eine "Erinnerung" daran, wie sie
vorher war.
Was wir für
stabil halten – beeindruckt durch die scheinbare Festigkeit
dessen, was wir Materie nennen –, ist nur ein labiles
Gleichgewicht, das durch Dynamik eine gewisse Stabilität erlangt
hat. Dürr vergleicht dies mit dem Gehen. Solange wir auf einem
Bein stehen, sind wir, statisch betrachtet, instabil. Wir wechseln
aufs andere Bein und sind in der gleichen instabilen Lage. Beim Gehen
jedoch wechseln wir dynamisch von einer Instabilität in die
andere und erreichen so einen dynamisch stabilen Gang (S. 106).
Diese Art,
die Welt zu begreifen, löst ebenfalls die Grenze zwischen Natur-
und Geisteswissenschaft auf. In der Quantenphysik herrscht eine
mehrwertige Logik. Dies ähnelt wesentlich den Gefühlen, die
sich einem wirklichen Greifen entziehen. Beschreibend können wir
uns verstehend annähern, aber auch bei ihnen bleibt eine
„Unschärferelation“. Hier behelfen wir uns mit
Begriffen wie „atmosphärisch“ oder dass wir etwas
„ahnen“. Etwas bewegt uns, bringt uns zum Schwingen,
bringt uns in Resonanz. Letztlich aber gilt immer noch das Heine
Wort: „Was Liebe ist, das hat noch keiner
herausgefunden“.
Diese Unschärfe gibt es ebenfalls in
der modernen physikalischen Welt. Und daher mag Dürr nicht mehr
von Teilchen oder vom Atom sprechen.
Jene Welt, die die alte Physik
mit ihrem mechanistischen Weltbild beschreibt, mag für unseren
Alltag ausreichen, trifft aber nicht das Ganze. Deshalb gebrauche ich
ja die Begriffe Teilchen oder Atom nicht mehr und sage
stattdessen Wirks oder Passierchen. Diese Wirks oder
Passierchen sind eine winzige Artikulation der Wirklichkeit, etwas,
das wirkt, das passiert, das etwas auslöst. Betrachten wir ein
instabiles System wie etwa ein nasses Schneefeld: Dort kann ein
kleiner Fuß eine riesige Lawine auslösen (S. 111).
Dürr
begegnete als junger Physiker in Amerika der ihn sehr beeindruckenden
Hannah Arendt. Er hörte verschiedene ihrer Vorlesungen und führte
einige Gespräche mit ihr. Dies brachte ihn später zu einer
politischen Haltung, die ihn sich in die Debatte um Atomkraftwerke
und Ökologie einbringen ließ. Er ist zugleich ein
Vertreter der Auffassung, dass es keine wertfreie Wissenschaft gibt,
woraus dem Wissenschaftler und eben auch dem Physiker eine
Verantwortung erwächst. Nicht alles, was wir etwa tun können,
dürfen wir tun, wenn wir eine ethische Haltung einnehmen. Auch
sollten wir die Hybris aufgeben, wir wüssten genau, was wir tun.
Die sogenannten objektivierenden Wissenschaften befassen sich
letztlich immer nur mit einem Ausschnitt dessen, was wir Wirklichkeit
nennen. Und jede Wissenschaft ist Ausdruck unseres Denkens, mit dem
wir der Welt unseren Stempel aufdrücken und somit wertend ihr
gegenübertreten. Mag sein, dass die Naturwissenschaften in ihren
Laboren und soweit sie Grundlagenwissenschaft betreiben, eine gewisse
Wertfreiheit bezielen. Sobald sie aber angewandte Wissenschaft
werden, verlieren sie endgültig ihre Unschuld. So
unterschrieben u.a. viele Wissenschaftler der Max-Planck-Gesellschaft
eine von der Regierung Helmut Schmidt erwünschte Erklärung
zur Unbedenklichkeit der Kernenergie in Kraftwerken. Dürr
unterschrieb nicht, womit er einigen Mut bewies. Für seine
fundierte Kritik der strategischen Verteidigungsinitiative
(weltraumgestützter Abwehrschirm aus Ronald Reagens Zeiten)
erhielt er den Alternativen Nobelpreis. Leider hat er auch das
Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik von Otto Schily entgegen
genommen, obwohl seine Verdienste für das Gemeinwohl sicherlich
unbestritten sind.
B. Kuck 
Juli
2014
|
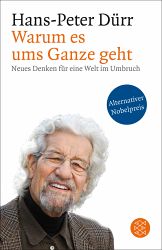
|
Oder in der nächstgelegenen Buchhandlung!
So landen die Steuereinnahmen zumindest in "unserem"
Steuersäckel, was theoretisch eine Investition in Bildung und
Erziehung ermöglichen würde.
In Bonn-Bad Godesberg z.B. in der
Parkbuchhandlung

|