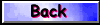Bartuska,
Buchsbaumer, Mehta, Pawlowsky, Wiesnagrotzki (Hrsg):Psychotherapeutische
Diagnostik. Leitlinien für den neuen Standard. Springer, Wien, New York
2005, 290 Seiten, EUR 34,80
Die
International Classification of Diseases (ICD) hat den Anspruch,
psychologische und psychiatrische Störungen weltweit gültig zu klassifizieren.
Die internationalen Autoren sind sich der dabei auftretenden Schwierigkeiten
durchaus bewusst, wie im Vorwort der 10. Ausgabe ausführlich nachzulesen ist.
Gleichwohl handelt es sich um ein durchgängig brauchbares, in der täglichen
therapeutischen Praxis nützliches Werk, das Diagnose und Differential-Diagnose
ausreichend anhand von nachvollziehbaren Unterscheidungskriterien beschreibt. Im
deutschen psychotherapeutischen Antragsverfahren scheint die ICD für die
Diagnosestellung durchaus
ausreichend. Jedes neu erschienene Buch zur psychotherapeutischen Diagnostik –
wie auch das hier vorliegende – muss sich fragen lassen, ob es mehr leisten
kann, als das, was die ICD für das deutsche Gutachterverfahren bereit hält. Es
sollte in diesem Zusammenhang zusätzlich daran erinnert werden, dass die Kassenärztlichen
Vereinigungen Merkblätter zur Erstellung der Berichte bereit halten, aus denen die Vorgehensweise und damit auch jene Punkte, auf die geachtet werden
sollte, hervorgehen.
Aus deutscher Sicht bringt das vorliegende Buch – in einem Satz gesagt – wenig
Neues. Es ist auch gar nicht auf den deutschen, vielmehr auf den österreichischen
Psychotherapiemarkt zugeschnitten. Und das kam so: 1995 entstand im Rahmen der
Europäischen Assoziation für Psychotherapie die Idee, ein europäisches
Zertifikat für Psychotherapie ins Leben zu rufen, d.h. einen gemeinsamen
Mindeststandard für die Psychotherapie-Ausbildung und –Anwendung in Europa zu
formulieren. Dieses Buch nun stellt den Standard für die psychotherapeutische
Diagnostik dar, jedoch im Hinblick auf Österreich, wo sich offensichtlich gut
zwei Dutzend verschiedene psychotherapeutische Schulen um Patienten bemühen.
Die Leitlinien für Diagnostik ergänzen und präzisieren das österreichische
Psychotherapiegesetz von 1990 (in Kraft seit 1.1.1991).
Das schien auch nötig zu sein, denn obwohl auch in Österreich eine Diagnose nach
der ICD gefordert wird, gefielen sich die Schulen in einer unübersichtlichen
Vielfalt von babylonisch anmutenden Grundannahmen und Verfahrensweisen. In einem
offenbar ziemlich komplexen Prozess, in welchem die Schulen zuvörderst ihre
Partikularinteressen zu erhalten suchten, wurden einige Selbstverständlichkeiten
des diagnostischen Prozesses herausgearbeitet. Damit konnte immerhin ein Schritt
zur Etablierung eines Mindestqualitätsstandards getan werden. Die
Diagnostik-Leitlinien wurden vom österreichischen Gesundheitsministerium am 15.
Juni 2004 veröffentlicht. Die Leitlinien, die auch einige hilfreiche Hinweise
zur Indikationsstellung beinhalten, schweben sozusagen oberhalb des brodelnden
Kessels unterschiedlicher rivalisierender Therapieschulen und bewegen sich
tendenziell in Richtung auf eine "Einheits-Psychotherapie", was die
einzelnen Schulen erklärtermaßen fürchten wie der Teufel das Weihwasser.
Die Leitlinien selbst umfassen nur drei Dutzend Seiten; der Hauptteil des Buches
sind Stellungnahmen von knapp 20 Schulen-Vertretern zu den Leitlinien, die
allesamt zu dem Schluss kommen, dass die Leitlinien wunderbar in genau ihr
Therapiekonzept passen. Die in den Stellungnahmen zutage tretende Eitelkeit der
Selbstdarstellung hat etwas leicht Absonderliches. Trotz unterschiedlichster
Menschenbilder behaupten sie alle, für alle Störungen zuständig zu sein. Doch
wenn alle Therapieformen für alle Patienten geeignet sind, macht der so oft
betonte "methodenspezifische Reichtum" wenig Sinn. Es bedarf keiner
"Hypnose-Psychotherapie" (deren Wirksamkeit kürzlich in Deutschland vom
"Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie" als weitgehend unbewiesen
eingestuft wurde), um daran zu denken, mit den Patienten Therapieziele zu
vereinbaren. Übrigens kommt im Kapitel über Hypnose-Psychotherapie kein
einziges Mal Hypnose als Therapiebestandteil vor. Die Kathatyme Imaginative
Psychotherapie kommt zur Diagnostik angeblich über Imagination, statt die
Patienten direkt zu befragen. Die Konzentrative Bewegungstherapie kann weder
ihre Konzentration noch ihre körperliche Bewegung für eine Diagnostik
einsetzen. Die tiefenpsychologischen Schulen einschließlich der Psychoanalyse fürchten
bis heute eine Etikettierung von Patienten, während umgekehrt das Psychodrama
bewusst am "positive labeling" (Hervorhebung der positiven vorhandenen
Ressourcen eines Patienten) arbeitet. Nicht wenige Therapieschulen haben sich
bis dato kaum mit Diagnostik abgegeben und lehnten sie sogar teilweise ab, so
dass die Leitlinien letztlich doch einen wichtigen Schritt hin zur
Professionalisierung darstellen (z.B. bei den Rogerianern) (S. 140).
Die Leitlinien sind geeignet, die Therapieschulen aus ihrer esoterischen Ecke
herauszuholen, aber es verfestigt sich der Eindruck, dass die an Schulen
klebenden Therapeuten die diagnostische Phase schnell hinter sich bringen
wollen, um mit den Patienten endlich auf ihre je eigene Art spielen zu können.
Eine Verlaufskontrolle scheint ohnehin niemand anzubieten, aber so etwas gibt es auch
in Deutschland noch nicht.
Der Band schließt ab mit zehn Aufsätzen zu verschiedenen Aspekten der Diagnostik
in Medizin und Psychosomatik und zu Grundbegriffen wie Leiden, Störung,
Krankheit, Persönlichkeit, Persönlichkeitsstörungen, therapeutische
Beziehung, Krise und Selbsterfahrung. Es zeigt sich u.a., dass auch in Österreich
die meisten Therapeuten (über 90 %) mit dem Klassifikationssystem ICD arbeiten.
Diskussionswürdig scheint mir die These von Anton-Rupert Laireiter, die
psychotherapeutische und die klinisch-psychologische Diagnostik würden sich
unterscheiden. Wenn die beiden Bereiche bei ein und demselben Patienten zu
unterschiedlichen Ergebnissen kommen, verweist das einerseits auf die bekannten
Schwierigkeiten bei der Diagnose psychischer Störungen, andererseits leider
auch auf eine gewisse Beliebigkeit der Diagnosestellung. Die beteiligten Autoren
lassen noch einmal die Schwierigkeiten bei der Definition von Krankheit, Störung,
therapeutische Beziehung usw. Revue passieren. Interessant scheint mir der
Hinweis von Gerda Mehta, dass die Hervorhebung von spezifischen Faktoren im
psychotherapeutischen Prozess durch die einzelnen Schulen im Sinne einer
Komplexitätsreduktion zum Zwecke der leichter planbaren Gestaltung des
psychotherapeutischen Prozesses erfolgt. Erneut und drängend stellt sich mir
dabei die Frage, wie die einzelnen Schulen ihre Behauptung aufrecht erhalten
wollen, unter dieser Prämisse das "Wesen" des Patienten oder seine
Ganzheitlichkeit erfassen zu können.
Gerald Mackenthun,
Berlin/Magdeburg
Juli 2006


Oder in der nächstgelegenen
Buchhandlung! So landen die Steuereinnahmen zumindest in
"unserem" Steuersäckel, was theoretisch eine
Investition in Bildung und Erziehung ermöglichen würde.
In Bonn-Bad Godesberg z.B. in der
Parkbuchhandlung