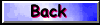Kast, Bas (2007): Wie der Bauch dem Kopf
beim Denken hilft. Die Kraft der Intuition. S. Fischer Verlag,
Frankfurt/Main.
Bei schwierigen
Entscheidungen hilft es manchmal, das Pro und Contra einer jeden
Alternative aufzuschreiben, zu gewichten und die vergebenen Punkte
zusammen zu zählen. Es gibt drei mögliche Ausgänge
dieses Verfahrens: der erste ist ein Patt, und man ist so schlau wie
vorher. Der zweite: man bekommt ein eindeutiges Ergebnis, entscheidet
aber doch anders aufgrund von Intuition und Gefühl. Dritte
Möglichkeit: man manipuliert das Ergebnis unbewusst so, dass das
herauskommt, was man ohnehin wollte.
Man sieht, die
Ratio führt nicht allzu weit. Der Berliner
Wissenschaftsjournalist Bas Kast macht daraus eine These: Wer denken
will, muss auch fühlen können. Intuition ist immer im Spiel
und hilft uns, Entscheidungen ohne viel Nachdenken zu treffen. Seines
Erachtens sind es sogar die besseren Entscheidungen, aber das darf in
dieser Verallgemeinerung bezweifelt werden. Jedenfalls kann der Autor
eine Menge neue Forschungsergebnisse vorweisen, die die heilsame
Wirksamkeit der Intuition und des Gefühls belegen. In der
Geschichte der Philosophie und Psychologie hörte man es bislang
eher umgekehrt.
Seit Descartes,
eigentlich schon seit den antiken griechischen Philosophen wird die
Vernunft und der Vernunftgebrauch als ultima ratio angesehen;
der Mensch solle sich von seinen Leidenschaften befreien, die ihn nur
allzu oft ins Unglück stürzen, und ein vernünftiges
Leben führen. Die affektive und intuitive Angst vor Fremden
beispielsweise äußerte sich in Rassismus, Nationalismus,
Vorurteile, Verfolgung bis hin zum Genozid. Hier auch mit sachlichen
Argumenten gegenzusteuern ist lebensnotwendig. Für einen
Rationalismus sprechen ebenso viele gute Gründe wie für ein
Ernstnehmen der Intuition.
Die Beispiele des
Autors sind tatsächlich eher aus dem Lebensalltag gegriffen:
Soll ich mich lieber für Orangen- oder Himbeer-Marmelade
entscheiden? Kasts These ist, auf eine Formel gebracht: „Während
sich die Ratio oft beschränkt, eindimensional, um nicht zu
sagen, dumm verhält, erweist sich das vermeintlich Irrrationale
als offener, als etwas, dass häufig viele Seiten einer Sache
beleuchtet und sich damit auch klüger als die Ratio verhalten
kann" (S. 22). Die Dringlichkeit des Gefühls zeigt sich an
jenen Menschen, so Kast, die gar nichts mehr fühlen, die keine
Angst und keinen Ekel mehr besitzen, beispielsweise bei
Gehirnerkrankungen oder -beschädigungen. Kast wendet sich
deswegen auch gegen Sigmund Freud, der das Unbewusste für etwas
Gefährliches, Bedrohliches und Böses hielt.
Aber Kast trifft
diesen Gegenstand nicht wirklich. Für Freud war das Unbewusste
etwas Archaisches, aus der Tiefe der Zeit Kommendes, das uns auf
oftmals ungute Weise beherrscht, ohne dass uns dies gewahr wird.
Dieses Unbewusste formt unsere Person mit, darin stimmt Kast mit
Freud überein.
Kast folgt im
Grunde einem amerikanischen Ansatz, der sich seit ein paar Jahren
bemüht, trennenden Affekten etwas Positives abzugewinnen, Neid
und Geiz beispielsweise, um daraus einen Nutzen für den
wirtschaftlichen Konkurrenzkampf zu erzielen. In diesem Sinne soll
auch das Unbewusste rehabilitiert werden, um unsere Person
ganzheitlicher zu verstehen und mehr Kreativität zu gewinnen.
Denn Kreativität ist – laut Kast – nicht das
Ergebnis nur von Fleiß und Ratio, sondern auch und vielleicht
mehr noch von Spontaneität, Freiheit und Mut. „Die Ratio
ist dazu da, unsere neuen Ideen und Gedanken zu prüfen. Die
Ideen selbst aber kommen aus den irrationalen Regionen in uns, aus
dem Unbewussten“ (S.26).
Das ganze ist
sehr kurzweilig, teilweise direkt lustig geschrieben und ohne Zweifel
äußert lesefreundlich. Beispielsweise der neue Blick auf
den Pedanten Immanuel Kant oder die Vorstellung vom Ich im antiken
Griechenland, welchem kaum einen eigenen Willen zugestanden, sondern
von Göttern gelenkt wurde. Oder Sokrates, der als
rationalistischer Nervtöter porträtiert wird.
Die Stoiker
kommen bei Kast nicht besonders gut weg, weil sie angeblich die
Emotion ausmerzen wollten. Hier scheint der Autor erneut etwas
durcheinander zu bringen. Die Stoiker wollten ihre Leidenschaften
zügeln, sie wollten nicht gefühllos werden. Leidenschaften
wie Wollust, Glaubenwut oder Jähzorn sollten in Schach gehalten
werden. Die Vernunftphilosophie postulierte, dass der Mensch diesen
bösen Trieben nicht hilflos ausgeliefert sei.
Die bewusste
Ratio ist begrenzter, als die Vertreter der Vernunftphilosophie
annahmen, meint Kast, anderseits sei auch die Intuition nicht gerade
perfekt (S. 73). Beide haben Stärken und Schwächen und
sollten zusammenarbeiten. Wir brauchen Angst, Ekel und Skepsis. Angst
mahnt zur Vorsicht, Ekel veranlasst zu Hygiene und Argwohn bewahrt
uns davor, jedem X-Beliebigen zu vertrauen. Wie jede menschliche
Eigenschaft können auch diese Seelenregungen übertrieben
werden. Angst, Ekel und Argwohn können uns lähmen; wer
überkritisch ist, findet nie einen Partner.
Es ist
unbestritten und inzwischen Allgemeingut, dass das Unbewusste
wesentlich größer ist als das Bewusstsein, ausgedrückt
in der Verarbeitungskapazität (d.h. Bit-Einheiten). Hirnforscher
schätzen, dass uns weniger als 0,1% dessen, was das Gehirn tut,
aktuell bewusst wird. Aber der Verstand hält seinen kleinen
beleuchteten Ausschnitt für das Ganze; schon Freud wies auf
diesen Irrtum hin.
Im Verlauf des
Buches fächert sich die Argumentation immer weiter auf und wird
differenzierter. So ist zum Beispiel wichtig festzustellen, dass
Intuition dann gut funktioniert, wenn man bereits ausreichendes und
umfangreiches Wissen angesammelt hat. Man kommt schnell zu einem
treffsicheren Urteil, wenn man auf dem Gebiet schon ein Experte ist.
Der Verstand ist ohne die Unterstützung der Emotion ein
zahnloser Tiger, unfähig, dass, was er für richtig hält,
auch durchzuziehen.
Wie so viele
andere Forscher geht der Autor nicht von einer imaginierten Einheit
oder Ganzheit des Menschen aus, vielmehr sei das Ich aus
verschiedenen Schichten zusammengesetzt. Eine der großen
Unterscheidungen sei die zwischen dem bewussten Sprach-Ich und dem
weitgehend unbewussten Erfahrungs-Ich. Es mag auch viel
Unverstandenes in uns sein, aber das Unbewusste geht in seinem Umfang
deutlich darüber hinaus (S. 111).
Der Autor folgt
der These des deutschen Psychologen Oliver Schultheiss, der die drei
großen Motive Leistung, Bindung und Macht im Unbewussten
arbeiten sieht. Es gibt also nicht nur das Machtmotiv, wie Alfred
Adler und Friedrich Nietzsche annahmen, sondern weitere gleichrangige
Strebungen. Zudem ist Macht - trotz des unangenehmen Beiklangs -
nicht von vornherein etwas Böses. Menschen mit Machtmotiv
möchten überzeugen, ihre Kompetenz ausspielen und mit
Charme und List andere Menschen rumkriegen. Die Stärke des
Machtmotivs sagt wenig darüber aus, wie dominant jemand
erscheint, wohl aber wie überzeugend und kompetent er ist. Das
hängt auch damit zusammen, wie einer etwas sagt.
Dem Menschen gehe
es dann besonders gut, wenn das bewusste Sprach-Ich möglichst
jene Entscheidungen trifft, die bereits im unbewussten Erfahrungs-Ich
liegen. Umgekehrt bedeutet das, wir fühlen uns unwohl, wenn wir
uns rational für Dinge entscheiden, denen wir unbewusst oder
emotional abgeneigt sind. Das bewusste Selbstbild ist mit den
unbewussten Bedürfnissen nicht immer kongruent.
Auch der
Affenforscher Franz de Waal neigt der grundsätzlichen These vom
"zerrissenen Ich" zu. Zum Menschen schreibt er: "Nie
hat ein Tier mit einem größeren inneren Konflikt auf
dieser Erde gelebt." In der Tierwelt und bei Kleinkindern
regierte das Erfahrungs-Ich. Eine der zentralen Funktionen der
Sprache scheint in der Koordination großer Gruppen bis hin zu
Gesellschaften zu liegen. Kein Säugetier lebt in so großen
und so komplexen Gruppen wie der Mensch (S. 119/120).
Die
Unterscheidung in Sprach-Ich und Erfahrungs-Ich führt zu einer
gründlichen Theorie der Kreativität. Ein turbulentes
Gefühlsleben scheint gerade bei den Kreativen
überdurchschnittlich oft eine Rolle zu spielen. Bei Musikern,
Schriftstellern und Wissenschaftlern zeigt sich oftmals ein bipolar
angelegtes Seelenleben; auf manische Phasen folgt früher oder
später ein depressiver Absturz. Bei kreativen Genies trifft man
erstaunlich häufig auf Stimmungsschwankungen in Form einer
bipolaren Störung. Sie gehen aber nie soweit, dass es zum
Wahnsinn kommt - mit einigen Ausnahmen wie Friedrich Nietzsche,
Heinrich von Kleist oder Robert Schumann. Beethovens Genie beruht
offensichtlich nicht auf einer späteren Taubheit, sondern auf
schon früh einsetzende bipolare Stimmungsschwankungen. Er stand
schon als junger Mann kurz vorm Selbstmord und trank sich in seinem
späteren Leben zu Tode. Auch Schumann war dem Alkohol verfallen.
In einer Untersuchung der Biografien von über 1000 bedeutenden
Figuren des 20. Jahrhunderts belegen Schriftsteller und Dichter
sowohl in der Kategorie Depression als auch in den Kategorien
Alkoholismus und Suizid die Spitzenplätze (S. 139; Kast bezieht
sich auf Ludwig, A. (1995) The price of greatness. Guilford,
New York).
Wie es scheint,
werden in einer Manie jene Teile des bewussten Verstandes
heruntergefahren, die normalerweise die Funktion der Zensur oder des
Filters im Kopf übernehmen und Assoziationen, die aus dem
Unbewussten aufsteigen, abfangen. Freud hatte dazu das Bild von den
zwei Zimmern und dem Türsteher benutzt. In einer Manie macht der
Türsteher gewissermaßen Urlaub oder ein Nickerchen. Es
sollte aber eine leichte Manie sein, eine Mikromanie, die den Filter
im Kopf etwas durchlässiger macht. Die Depression bewirkt das
Gegenteil der Manie. Sie bremst den Gedankenfluss ab und gibt dem
Türsteher eine Chance. Aber allzu viel Vernunft scheint ein
Kreativitätskiller zu sein. Jedenfalls liegt die Quelle der
Kreativität im Unbewussten, aber nur Manie und nur Depression
macht keinen kreativen Menschen.
Weil das Gehirn
eine nur geringe Verarbeitungskapazität hat, konzentriert es
sich selektiv auf relevante Informationen. Selektive Wahrnehmung ist
offenbar nicht von vornherein ein Neurotizismus, wie Adler meinte,
sondern eine strukturell vorgegebene Arbeitsweise des bewusst
arbeitenden Teils des Gehirns. Es interessiert sich für
übergeordnete Konzepte, die sich aus den Details ergeben.
Informationen werden eingedampft auf wichtige Kategorien wie
bekannt-unbekannt, Feind-Freund, gefährlich-ungefährlich,
essbar-ungenießbar etc. Das Gehirn unterdrückt Details zu
Gunsten eines überschaubaren Gesamtbilds. Das Gehirn ist darauf
angelegt, Muster zu erkennen, beispielsweise Gesichter. Ohne die
Details eines Gesichts im einzelnen zu realisieren, erkennen wir ein
bekanntes Gesicht in Bruchteilen von Sekunden wieder. Wir erkennen
auch Muster, wo keine sind: in den Wolken, im Sternenhimmel, auf der
Mondoberfläche oder im Kaffeesatz. Je starrer und eingefahrener
diese Muster, desto mehr pressen wir die Wirklichkeit in unsere
Schemata.
Als
Kind lernen wir (in der synthetischen Methode) erst die Buchstaben,
dann die Wörter und dann lesen wir die Sätze. Als
Erwachsene sehen wir nicht mehr die Buchstaben, allenfalls noch
einzelne, schwierige Wörter, und nicht einmal mehr die Sätze,
sondern wir behalten nur noch die Bedeutung im Kopf. Alle Details,
die keine Bedeutung für das Ganze haben, werden eliminiert. Der
Trend zu optischen Zusammenfassungen ist ein Problem für das
Erkennen und für die Frage, was Realität ist. Sprache
effektiviert die Kooperation, macht aber zugleich blind für die
sinnlichen Details der Wirklichkeit. Der Logos – sowohl das
Sprechen als auch das Denken – hat seine Grenzen und sollte, so
Kast, durch die eher assoziative Bildersprache in Liedern und Lyrik
ergänzt werden.
Gerald
Mackenthun, Februar 2008

direkt bestellen:

Wie der Bauch dem Kopf beim Denken hilft
Oder in der nächstgelegenen
Buchhandlung! So landen die Steuereinnahmen zumindest in
"unserem" Steuersäckel, was theoretisch eine
Investition in Bildung und Erziehung ermöglichen würde.
In Bonn-Bad Godesberg z.B. in der
Parkbuchhandlung