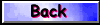Geuter, Ulfried: Praxis Körperpsychotherapie.
10 Prinzipien der Arbeit im therapeutischen Prozess, Springer, Berlin 2019, 508 S., 44,99 €
Der erste Band (Körperpsychotherapie) erschien 2015. Darin war der vorliegende Folgeband schon angekündigt und wurde mit Interesse erwartet. Schon der erste Band enthielt viele praktische Beispiele, der Folgeband ist ganz der Praxis gewidmet und eine echte Bereicherung. Querverweise zum ersten Band laden zur Vertiefung der theoretischen Aspekte ein.
Geuter vertritt eine ganzheitliche, relationale Position in der „Körperpsychotherapie“, die eben nicht auf bloße Einbeziehung von „Techniken“ oder „Körperarbeit“ in die Psychotherapie gründet. Das körperliche Erleben steht immer wieder im Fokus, wozu bestimmte Methoden zur Anwendung kommen, die eine Wahrnehmung des Leibes fördern und Zugänge zum Erleben über den Leib eröffnen.
„Wenn ich von »erlebniszentriert« spreche, meine ich nicht, Erlebnisse zu ermöglichen, sondern sich auf das Erleben als die subjektive Form des Erkennens zu richten“ ([Hervorhebung i.O.] S. 7).
Dabei möchte Geuter auch weiter von Patient*innen sprechen, da in diesem Begriff nicht nur das Leiden, sondern auch die Leidensfähigkeit angesprochen ist, die auch notwendig sein kann, wo sich „Jammer in erträgliches Leid wandeln kann“ (VIII). Von Klienten mag er hingegen nicht sprechen, da hier mehr die Kundenperspektive angesprochen ist. Zwar sind wir Psychotherapeut*innen auch Dienstleister*innen, reparieren aber nichts und vor allem haben wir es nicht mit dem „cliens (lat.)“ zu tun, also derie1 „Hörige“, „Halbfreie“ oder Lehnsnehmer*in – und wenn doch, dann ist dies eher therapiewürdig. Erfrischend geradezu, wenn die Beispiele aus der Therapie auch „Therapiebeispiele“ genannt werden, um so der Pseudoversachlichung (der „Fall“ ist eher ein juristischer) in der Rede vom „Therapiefallbeispiel“ zu entgehen. Sprache formt eben doch Bewusstsein!
Im Zentrum stehen daher auch nicht Diagnosen und „Störungen“, sondern der leidende Mensch, der immer das leidende Subjekt ist. So begegnen sich im therapeutischen Prozess zwei Subjekte in relationaler, intersubjektiver Weise, handelt es sich doch zutiefst um ein dialogisches Verfahren. Daher werden eben keine „Körperübungen“ angeboten, sondern die Interventionen auf der Spürebene ergeben sich kreativ aus dem therapeutischen Prozess. Die frühere Praxis in der „Körperpsychotherapie“, jede Sitzung mit einer Atemübung zu beginnen, verfehlte die Besonderheit des individuellen Prozesses. „Regeln sind für regelhaftes Verhalten gedacht, Prinzipien laden zu schöpferischem Handeln ein“ (S. 16). Daher die „zehn Prinzipien der Arbeit im therapeutischen Prozess“:
-
Wahrnehmen und Spüren
-
Gewahrsein und Gegenwart
-
Erkunden und Entdecken
-
Aktivieren und Ausdrücken
-
Regulieren und Modulieren
-
Inszenieren und Interagieren
-
Berühren und Halten
-
Zentrieren und Erden
-
Verkörpern und Handeln
-
Reorganisieren und Transformieren
Diese Prinzipien haben alle etwas Besonderes und kommen nicht unbedingt in dieser Reihenfolge im Prozess vor. Sich auf eine zu konzentrieren ist ebenfalls nicht sinnvoll – wie dies manche Schulen tun -, wodurch „leicht ein Dogmatismus des therapeutischen Vorgehens“ entsteht, „der auf die Vielfalt der Möglichkeiten verzichtet“ (S. 25).
Die Praxis in Geuters Variante der „Körperpsychotherapie“ ist immer prozessorientiert. Daher unterscheidet er zwischen Prozesszielen und Therapiezielen. Geht es bei letzteren um „Veränderung der Symptomatik, der Persönlichkeit, der seelischen Struktur“, so verfolgen Prozessziele zum Beispiel die Entwicklung von Fähigkeiten der Wahrnehmung, der Bewusstwerdung von Spannungen und diese zu regulieren, sich seiner Empfindungen und Emotionen bewusst zu werden. Dies hilft dann Therapiezielen näher zu kommen, etwa der Integration dissoziierter Persönlichkeitsanteile, der Überwindung von Panikstörungen oder der Auflösung einer somatoformen Schmerzsymptomatik (S. 38). Prozessorientierung heißt, Patient*innen an ihrem Erleben abholen. „Wir folgen dem, was sich zeigt“, setzen dabei „an den sprachlichen, körperlichen und atmosphärisch spürbaren Mitteilungen“ der Patient*innen an. Von der Oberfläche ausgehend spürt er den Phänomenen nach, die das Verborgene entbergen (Heidegger) (ebd.).
Bezüglich der Dosierung therapeutischen Handelns in der „Körperpsychotherapie“ vertritt Geuter ebenfalls die Ansicht, hier mit Augenmaß vorzugehen. Stimmigkeit, Flexibilität, empathische Begleitung des Prozesses bestimmen die Interaktionsangebote von Seiten derie Therapeut*in. „So wenig wie möglich, so viel wie nötig“ ist seine Maxime, geht es ihm doch nicht mehr bloß um Expressivität, wie dies früher in „körpertherapeutischen“ Schulen der Fall war.
„Denn der Patient sollte in der Lage bleiben, zu erfahren, was in ihm vorgeht, und die Kontrolle über den Prozess zu wahren, auch wenn er in einer einzelnen Situation einmal die Kontrolle aufgibt“ (S. 40).
Die Balance zwischen Sicherheit und Herausforderung gilt es für derie Therapeut*in zu halten, was durchaus bedeuten kann, das ersie solche fördert oder anregt. „Also Offenheit in jede Richtung, geleitet durch den Prozess“ ist Ausdruck der Grundhaltung solchen Arbeitens (ebd.). Dabei behagt Geuter die Rede von „Übungen“ nicht, die für meinen Teil immer die Assoziation zu gymnastischen Übungen heraufbeschwört und auch Patient*innen häufig vom eigentlichen Sinn prozesshaften Vorgehens abbringen. „Experiment“ oder „Angebot“ ist wohl zielführender, selbst der von Geuter verwandte „Vorschlag“ ist meiner Ansicht nach sprachlich ebenfalls problematisch, assoziieren manche Patient*innen mit Gewalterfahrung in der Kindheit hiermit Schläge (‚Vorschläge sind auch Schläge‘).
Entsprechend dieser Grundhaltung der Offenheit für den Prozess, gibt es im Setting auch keine Verhaltensregeln, wird der gesamte Arbeitsraum ders Therapeut*in zum „Möglichkeitsraum“, der darüber hinaus natürlich auch allerlei Arbeitsmittel zur Verfügung hat, mit denen gehandelt und/oder symbolisiert werden kann (S. 50 ff.).
Wenn in der Psychoanalyse alten Stils die Deutung das Mittel der Wahl ist, so in manchen „Körperpsychotherapien“ die „Körperübung“. Beide verabreichen ihre ‚Technik‘ wie eine Medizin, die es zu schlucken gilt. Erlebniszentriertes Arbeiten hält hingegen das Subjekt im Zentrum
„und versucht einen Prozess zu gestalten, in dem sie [die Patientin, BK] von innen her ihre eigene Wahrheit entdeckt. Davon profitiert sie in der Regel mehr als von einer Deutung (Yalom, 1999, S. 157)“ (S. 69).
Im Folgenden werden nun die zehn Prinzipien genauer expliziert. Schlaglichtartig möchte ich das eine oder andere herausheben. Es lohnt sich aber sehr, die Prinzipien genauer zu studieren.
1. So sind etwa »Wahrnehmen und Spüren« die Grundvoraussetzungen, sich seiner Emotionen wirklich bewusst zu werden. Das Spüren ist wie das Hinhören oder das Hinschauen die Voraussetzung für Erkennen. In der Wahrnehmung und im Spüren somatischer Empfindungen tritt das „»wortlose Wissen mental in Erscheinung« (Damasio ...)“ (S. 89). Die schon in der Kindheit unbewusst abgewehrten konflikthaften oder defizitären Erfahrungen sind als Kompromissbildungen in die leibliche Existenz eingegraben. Diese emotional-prozeduralen Erinnerungen sind nicht wirklich verdrängt, sondern gegenwärtig. „Ihre Konfliktdynamik kann man daher in der Gegenwart spürend erschließen. Das Verstehen folgt dabei dem Spüren“ (S.104).
2. »Gewahrsein und Gegenwart«. Spürend nehmen wir Empfindungen wahr und werden ihrer gewahr, wenn wir die geistige Aufmerksamkeit darauf richten. Gindler wies darauf hin, dass die Menschen ihren Leib versuchen »anzudenken« statt ihn zu erspüren und zu erfahren. In der Haltung der Achtsamkeit wird es möglich, aus der denkenden Perspektive in die spürende zu kommen und damit zum Gewahrwerden der leiblichen Existenz. »Achtsamkeit« ist teilweise schon wieder in ihrem tiefsten Sinn entfremdet, wenn sie als »mentales Training« oder gar als »Optimierungsstrategie« eingesetzt wird. Im Sinne der Humanistischen Psychotherapie geht es jedoch nicht um „eine beobachtende Bewusstheit vom Körper (»to be mindful of the body«), sondern das Sein im Körper (»to be bodyful«)“ (S. 128).
3. »Erkunden und Entdecken«. Für Perls bedeutete Lernen etwas zu entdecken und Heisterkamp hat in seiner therapeutischen Entwicklung mehr und mehr das Aufdecken zugunsten des Entdeckens aufgegeben. „Wer aufdeckt, weiß, wonach er sucht, wer entdeckt, lässt sich auf einen Suchprozess mit offenem Ausgang ein (...)“ (S. 132). Erst kürzlich hat Jürgen Kind (Das Tabu. Was Psychoanalytiker nicht denken dürfen, sich aber trauen sollten.) die Einschränkungen in der Entwicklung der Psychoanalyse darauf zurück geführt, dass die Adepten nach Freud meinten, nichts mehr entdecken zu müssen, da Freud ja schon alles gefunden hat, er also nur noch anzuwenden und auszulegen sei. Zu welchen Problemen dies führen kann zeigt sich etwa in der Arbeit von Steinberger ( Borderline-Kommunikation.), der findet, was er sucht, aber keinem offenen Suchprozess mehr folgt. Assoziativ äußert sich der Leib „selbst und nicht nur deren Versprachlichung“. Die Psychoanalyse hat durchaus die Wahrnehmung des Leibes in ihr Assoziationsrepertoire aufgenommen, dabei jedoch nur um die sprachliche Artikulation des Leibes erweitert (S. 139), um dann darüber nachzudenken (siehe etwa: Alessandra Lemma: Der Körper spricht immer. Körperlichkeit in psychoanalytischen Therapien und jenseits der Couch. Brandes & Apsel, Frankfurt/M. 2018).
Beim Erkunden kann es durchaus zu ausgeprägten regressiven leiblichen Äußerungen kommen. Downing prägte für dieses Geschehen den Begriff der »Körperregression«.
„Bei einer Körperregression ist ein Patient in einem vorübergehenden Zustand, in dem eine Erfahrung aus der Kindheit mit körperlicher Eindringlichkeit in den Vordergrund des Erlebens und Verhaltens tritt“ (S. 140).
Mimik und Gestik der Patient*innen erfahren besondere Aufmerksamkeit und werden etwa durch Verstärkung oder achtsames Erspüren in die Wahrnehmung und eventuell auftretende Impulse in die leibliche Bewegungserkundung entwickelt.
4. »Aktivieren und Ausdrücken«. Wenn Patient*innen ihre Emotionen überreguliert haben, ist es hilfreich mit Hilfe von aktivierenden oder den Ausdruck fördernden Angeboten die Vermeidung oder Hemmung der bewussten Erfahrung zugänglich zu machen. Hinsichtlich der Aktivierung geht es Geuter um die Erfahrung der „kernaffektiven emotionalen Erregungsspannung“ (S. 160). Hier geht es nicht um „Entladung“, wie die Bioenergetik dies früher anstrebte, auch nicht um Katharsis oder Ausagieren, da sich so keine Blockaden wirklich auflösen lassen, ja bei traumatisierten Patient*innen durch das „Entladungs-Konzept“ Schaden angerichtet wurde (S. 162).
„Solche Bewegungen können nicht gezielt Wut, Trauer oder Angst auslösen. Indem sie aber willkürlich die kernaffektive Aktivierung erhöhen, regen sie unwillkürliche emotionale Prozesse auch auf der Ebene der kategorialen Emotionen an“ (S. 164).
Die erlebniszentrierte Arbeit mit dem Ausdruck der Emotionen dient nicht dem Ausagieren von Emotionen oder der Entladung von Erregung, sondern es geht darum „etwas fühlen zu können, das man bislang nicht fühlen konnte“ (S. 173). Zugleich geht es darum, die Fähigkeit zur Steuerung der Gefühle zu stärken oder zu entwickeln.
„In einer Therapie eine Wut lediglich herauszuschreien, kann sie verstärken. Therapeutische Transformation sollte daher mit einer neuen Bewertung einhergehen, die einen sprachlichen Ausdruck findet“ (ebd.).
So ist es wichtig und notwendig, das Bedürfnis zu explorieren, dessen Verletzung wütend macht. Ohne den Bezug auf das hinter der Wut liegende Bedürfnis ist eine Arbeit mit dem Wutaffekt nicht sinnvoll und auch nicht hilfreich (S. 181).
5. »Regulieren und Modulieren«. Gerade in Bezug auf die lange Zeit unterschätzte Bedeutung traumatisierender Erfahrungen ist es zunehmend wichtig, Trauma bedingte Erlebnisweisen und vor allem Überflutungen zu regulieren und zu modulieren. Nach einer Erhebung an vier psychiatrischen Kliniken in NRW haben 90% aller Patient*innen in ihrer Vorgeschichte emotionale Vernachlässigung, emotionale und/oder körperliche Gewalt, sexuelle Belästigungen oder Gewalt erfahren (S. 196). Da eine dauerhafte Veränderung der Emotionsregulierung implizite Prozesse notwendig machen, die auf neuen emotionalen und relationalen Erfahrungen beruhen, ist die therapeutische Beziehung von grundlegender Bedeutung (S. 200). Die Selbstregulation lernen die Patient*innen vorrangig in einer Sicherheit spendenden therapeutischen Beziehung, analog zum Erlernen der autoregulatorischen Fähigkeit des Kindes in der Koregulation durch eine bedeutsame Beziehungsperson. Nach der Polyvagaltheorie von Porges ist die Voraussetzung dazu die Aktivierung des Bindungssystems in der emotionale Sicherheit gewährleistenden zwischenmenschlichen Beziehung. Manchmal ist die Rede davon, dass Traumata, die nicht benannt werden können, im Körper sitzen. Gleiches kann auch von Depressionen oder anderen Symptomatiken gesagt werden. Dabei sieht Geuter dies eher unter ganzheitlichen Gesichtspunkten. Ein nicht verbalisiertes Trauma sitzt auch in Gedanken, etwa in selbstabwertenden inneren Kommentaren (S. 206). Solche Betrachtungs- und Redeweise geht auf die künstliche Aufteilung in Körper, Seele, Geist zurück und löst sie nicht wirklich auf. Bei dem Gewahrwerden eines Ortes als sicher, etwa des Therapieraumes, ist es notwendig, dies im Spüren seiner selbst zu erfahren. „Wohlbefinden kann nicht in der Imagination gefühlt werden, sondern nur im Körper“ (S. 215). Gleichwohl wissen wir aus dem Somatic Experiencing, dass die Erinnerung an eine sichere Situation die zugehörigen Empfindungen im Leib entstehen lässt.
Mit Hilfe verschiedener Angebote lassen sich Emotionen regulieren, auch ohne sich mit der eigentlichen beängstigenden Bedeutung zu befassen. Ebenfalls kann durch Verstärkung der Emotion, zum Beispiel der Angst, die Erfahrung zugänglich werden, „das sie weniger wird, wenn“ ersie (derie Patient*in) „mit dem Bemühen um ihre Verstärkung aufhört“ (S. 220).
„Somatic Experiencing ist im Grunde eine Methode, bei der durch Vollendung unvollendeter Handlungen unterbrochene Kreisläufe geschlossen werden. Das ist ein gestalttherapeutisches Prinzip und geht auf die Erkenntnis der Gestaltpsychologie zurück, dass Menschen unvollendete Handlungen zu Ende bringen möchten, den sogenannten Ovsiankina-Effekt“ (S. 222).
6. »Zentrieren und Erden«. Dies sind Elemente aus der bioenergetischen Arbeit. Sie führen in der achtsamen Wahrnehmung nicht nur aus dem Kopf – und damit oft aus Gedanken, die Angst und Panik forcieren -, sondern erden im wahrsten Sinne des Wortes, was als Notfallmaßnahme bei Dissoziation sehr hilfreich ist..
7. »Berühren und Halten«. Einige Therapeuten halten durchaus auch in verbalen Behandlungen die Hand oder trösten mit einer Geste, umarmen Patient*innen durchaus. Studien zeigen, dass sie dies häufiger tun als sie es zugeben.
„85 % der Therapeuten geben an, ihre Patienten zu umarmen, etwa 65 % schätzen Berührungen als ergänzende Hilfe zur verbalen Therapie“ (S. 251).
Zu Freuds Zeiten war die Distanz zu hysterischen Patientinnen sinnvoll, waren doch ihre Fantasiewelten sexualisiert. Für viele andere war dieses Berührungsverbot schmerzhaft und abträglich, worauf Cremerius hinwies (S. 252). Nicht berühren bedeutet die Opferung eines Kommunikationskanals, einer wesentliche Möglichkeit, Fragen an die Patient*innen zu richten, die verbal nicht durchdringen. Im Unterschied zu physiotherapeutischen Behandlungen wollen wir dabei nicht nur etwas mit dem Leib tun, sondern reflektieren „die Bedeutung einer Berührung im Rahmen des therapeutischen Dialogs“ (S. 254) ergründen. So können in der Berührung Übertragungsgefühle sehr schnell deutlich und spürbar in Erscheinung treten, wozu die rein verbale Psychotherapie lange benötigt, bis sich diese Klarheit einstellt. Durch die Berührung wird das Berührungsgedächtnis oder Leibgedächtnis aktiviert. Wird dies qualifiziert und respektvoll durchgeführt, werden emotionale oder leibliche traumatische Erfahrungen zugänglich, die lange Zeit im Leib ‚eingefroren‘ waren. Beim Auftauchen schwer erträglicher Gefühle reicht ein verbaler Halt oft genug nicht aus, „ebenso wenig wie die »notwendige emotionale Beruhigungsfunktion einer mütterlichen Person … durch Denkbemühungen aktiviert« wird (Rudolf, 2006, S. 89)“ (S. 265). Patient*innen können ihre Affekte besser regulieren, wenn derie Therapeut*in den ganz realen Leib anbieten und so eine korrektive Erfahrung ermöglichen, die sich auf impliziter Ebene inkorporiert, zumal wenn diese Patient*innen solche Erfahrungen in Kindertagen nie machen konnten.
Um Ruhe und Halt zu vermitteln, kann die Technik der Polarisation angewandt werden. Diese Vorgehensweise stammt aus der Bioenergetik und meint ein Halten ders Patient*in in Seitenlage. Dabei legt derie Therapeut*in eine Hand in den Nacken, die andere auf den Bauch ders Patient*in.
„Die Technik wird Polarisation genannt, weil mit ihr die Vorstellung verbunden ist, eine nach außen flottierende Erregung werde in einem Pulsationsfeld zwischen der Vorderseite des Bauches und dem Nacken gesammelt. Die Beruhigung entsteht wohl schon deshalb, weil die Hände hier die beiden Enden der Atembewegung berühren und so die Berührung den Raum für diese Bewegung öffnet“ (S. 269).
Je intensiver oder auch großflächiger die Berührung ist, desto klarer müssen Therapeut*in und Patient*in mit der Berührung einverstanden sein und sie insgesamt als stimmig wahrnehmen. Fehlt die Stimmigkeit, die sich in der Regel nur erspüren lässt, sollte sie nicht ausgeführt werden. Etwa wenn derie Therapeut*in sich selbst nach der Berührung sehnt. Hier greift das Abstinenzgebot, das es auch in der „Körpertherapie“ gibt. Dabei geht es nicht um ein Berührungstabu, sondern darum, dass die innere Haltung ders Therapeut*in eindeutig ist und frei von eigener Bedürftigkeit. Abstinenz ist auch für Geuter eine Frage der Ethik therapeutischen Handelns. Die Angst vor Sexualisierung oder sexuellen Übergriffen in der Therapie ist im übrigen nicht verfahrensabhängig. Allerdings die Rationalisierungen für den Übergriff ders Therapeut*in sehr wohl abhängig von dem Verfahren, dass sie vertreten. Gründe liegen in einer Pathologie ders Therapeut*in, eigener narzisstischer Bedürftigkeit (S. 280) und unreflektierter Größenphantasien. Durch starre Regeln, wie dies die Psychoanalyse zu regeln versuchte und versucht ist nichts gewonnen. Vielmehr wird die Abwehr verstärkt, was erst recht zu Verletzungen oder gar Retraumatisierungen der Patient*innen führt. Sexuelle Erregung ist nicht immer auszuschließen, bedarf dann der Durcharbeitung von Übertragung und Gegenübertragung, auf jeden Fall ist eine Erfüllung sich hier zeigender Bedürfnisse ausgeschlossen. Entsprechend auch Berührungen, die einer solchen Erregung Vorschub leisten. Grundsätzlich aber ist Abstinenz „weniger ein Verhalten als vielmehr eine Haltung“ (S. 282).
8. »Inszenieren und Interagieren«. An einem Beispiel zeigt Geuter, dass es zu gravierenden Missverständnissen führt, wenn man versucht, mit einem Säugling zu telefonieren (Moser), das heißt, ihn immer wieder mit Fragen zu quälen, die er nicht beantworten kann, statt sich dem Enactment zu öffnen (S. 287). Soweit es sich um sogenannte frühe Störungen handelt, also solche, die in die vorsprachliche Zeit fallen, ist mit Sprache nichts mehr auszurichten. In der szenischen Handlung zeigt sich das implizite prozedurale Wissen, das so überhaupt erst einer Versprachlichung – oder Mentalisierung – zugänglich wird. Zum anderen kann von den Therapeut*innen eine szenische Interaktion angeboten werden, in der sowohl Rollenspiel, Spiegelung als auch eine szenische Bearbeitung früherer Erfahrungen in der Übertragungsbeziehung möglich sind. Wo sich derie Therapeut*in als ideale Figur zur Verfügung stellt (Pesso), geht es nicht um Wiedergutmachung oder darum gar als bessere Mutter oder besserer Vater zu agieren.
„Vielmehr dient die Erfahrung dazu, die resignative Position und das alte affektmotorische Schema zu schwächen, indem die Patientin heute spürt, dass es sich lohnt, ein Bedürfnis zu artikulieren und heute für Abhilfe der Not zu sorgen. Durch die neue Erfahrung mit der idealen Mutter wird so ein Gefühl für ein anderes affektmotorisches Schema gebahnt, mit dessen Hilfe ähnliche Situationen wie früher heute anders ausgehen könnten“ (S. 311).
9. »Verkörpern und Handeln«. Nach dem bisherigen Verständnis müssen neue Erfahrungen oder Erkenntnisse nicht nur mentalisiert werden. Bei den mentalisierungsbasierten Verfahren geht es wieder in Richtung Kognition, in Richtung der Überschätzung des Denkens (siehe auch: Lohmar, Denken ohne Sprache). Vielmehr kommt es darauf an, Kognitives dem Empfinden und Handeln zugänglich zu machen. „Mossetter und Mosetter (2014) nennen das eine »Korporifizierung«, die genauso wichtig sein kann wie die oft als »Psychisierung« bezeichnete Aufgabe, durch Worte Erfahrungen ins Bewusstsein zu heben“ ( [Hervorhebung i.O.], S. 316). Kritisch bleibt hier anzumerken, dass in solchen Formulierungen die Aufteilung des Leibes in einzelne Kompartimente nicht überwunden wird. Alles was die Person betrifft, muss im Spüren, Empfinden, Fühlen, Erleben und Denken verankert sein, wenn es zu nachhaltigen Veränderungen und Gestaltungen der Person kommen soll. Ähnlich formuliert es dann Geuter:
„In der Körperpsychotherapie streben wir ein verkörpertes Bewusstsein und eine Kongruenz zwischen den Vorstellungen und dem körperlichen Erleben an“ (S. 317).
Sehr viele Menschen unserer Kultur sind ihrem Leib entfremdet, „bewohnen“ ihn nicht eigentlich, sondern stehen in Opposition zu ihm. Bewegen allein reicht ebenfalls nicht hin, wenn sie zwar ausdrucksstark aber nicht mit der Existenz verbunden sind. So kommt es etwa zu dem Paradox, dass Tänzer*innen eine beachtliche Fähigkeit im „Körperausdruck“ haben, dennoch von sich und ihrem Innersten entfremdet bleiben können. Jedoch zeigt sich dann, dass es an Stimmigkeit fehlt, das innere Mitschwingen, die Resonanz beim Publikum ausbleibt – der Applaus ist hier durchaus kein Gradmesser. Das Erleben – nicht nur in therapeutischen Zusammenhängen – wird jedoch intensiver, wenn „eine erzählte Bewegung in einer realen Bewegung belebt wird“ ( [Hervorhebung i.O.] S. 336).
10. »Reorganisieren und Transformieren«. Unter Reorganisation versteht Geuter das Unterbrechen alter Muster. Darauf folgt eine Neuorganisation. Im Transformieren ist wesentlich ein prospektiver Aspekt bezielt, die Erkundung neuer Möglichkeiten, das Erschließen neuer Potentiale, die in ihrer eingeleibten Erfahrung maladaptive Erlebens- und Verhaltensweisen zu verändern vermögen.
„Positive, angenehme, als wirkmächtig empfundene verkörperte Erfahrungen können negative oder defizitäre Erfahrungen ausgleichen, das Denken, Fühlen und Handeln verändern und adaptives Erleben und Verhalten an die Stelle maladaptiver Muster setzen. Die Körperpsychotherapie stößt solche Erfahrungen mit ihren Möglichkeiten an“ (S. 343).
Wenn auch in der „Körperpsychotherapie“ dem Leib eine zentrale Position zukommt, so geht es zugleich immer darum, Erfahrenes und Erlebtes zu integrieren. Die sprachliche Reflexion hat daher ebenfalls ihren zentralen Ort. Es geht immer auch darum, seine Lebensgeschichte sinnstiftend erzählen zu können. Belastende Erfahrungen, die in einem Narrativ als vergangen eingeordnet werden können, verlieren ihren bedrängenden Charakter.
„Auch in einer Körperpsychotherapie nimmt die sprachliche, reflexive Auseinandersetzung mit Erfahrungen zeitlich den größten Raum ein“ (S. 358).
Es folgen noch Überlegungen zu Indikation und Kontraindikation. Grundsätzlich ist das Verfahren für alle psychotherapiewürdigen Anliegen geeignet. Jedoch hängt es wesentlich vom Strukturniveau der Patient*innen, welche Interventionen zur Anwendung kommen.
Die Sprache ist zunächst phänomenologisch ausgerichtet, versucht das Erlebte und Gespürte in Ichform zu beschreiben. Diese sinnlichen Wahrnehmungen gehen den Bedeutungen voraus, die dann erst gemeinsam ergründet werden.
„Wird Sprache dazu verwandt, körperliches Erleben ausschließlich im symbolischen Raum zu verorten, kann man die reale Lebendigkeit des Körpers verfehlen“ (S. 378).
Wird zum Beispiel ein Bauchgrummeln in einer psychoanalytischen Sitzung als symbolischer Ausdruck des Wunsches, sich den Analytiker einzuverleiben, gedeutet, verfehlt fran die Möglichkeit, dass derie Patient*in sich gerade in der therapeutischen Beziehung wohl fühlt und sich dies auf der physiologischen Ebene zeigt.
„Die vegetative Sprache wäre dann keine Symbolsprache, sondern ein Zeichen auf einer anderen Ebene der Körperkommunikation für diese emotionale Bedeutung (von Uexküll et al. 1994. S. 16)“ ( [Hervorhebung i.O.] ebd.).
Es konnten hier nur einige Aspekte anklingen, die Geuter aus seiner langjährigen Erfahrung mitteilt. Der gesamte Text ist mit sehr vielen Therapiebeispielen lebendig gehalten. So hat Geuter im ersten Band nicht zu viel versprochen. Die Lektüre ist anregend und inspirierend. Dabei schwingt zwischen den Zeilen immer mit, dass hier nicht einfach Methoden und Techniken zur Anwendung kommen. Daher lässt sich diese Arbeit nicht einfach als Handlungsanweisung lesen. Wer so vorgeht, und vor allem keine Selbsterfahrung hat, dem bleibt der Text verschlossen.
Bernd Kuck 
April
2019
-
|
direkt bestellen:
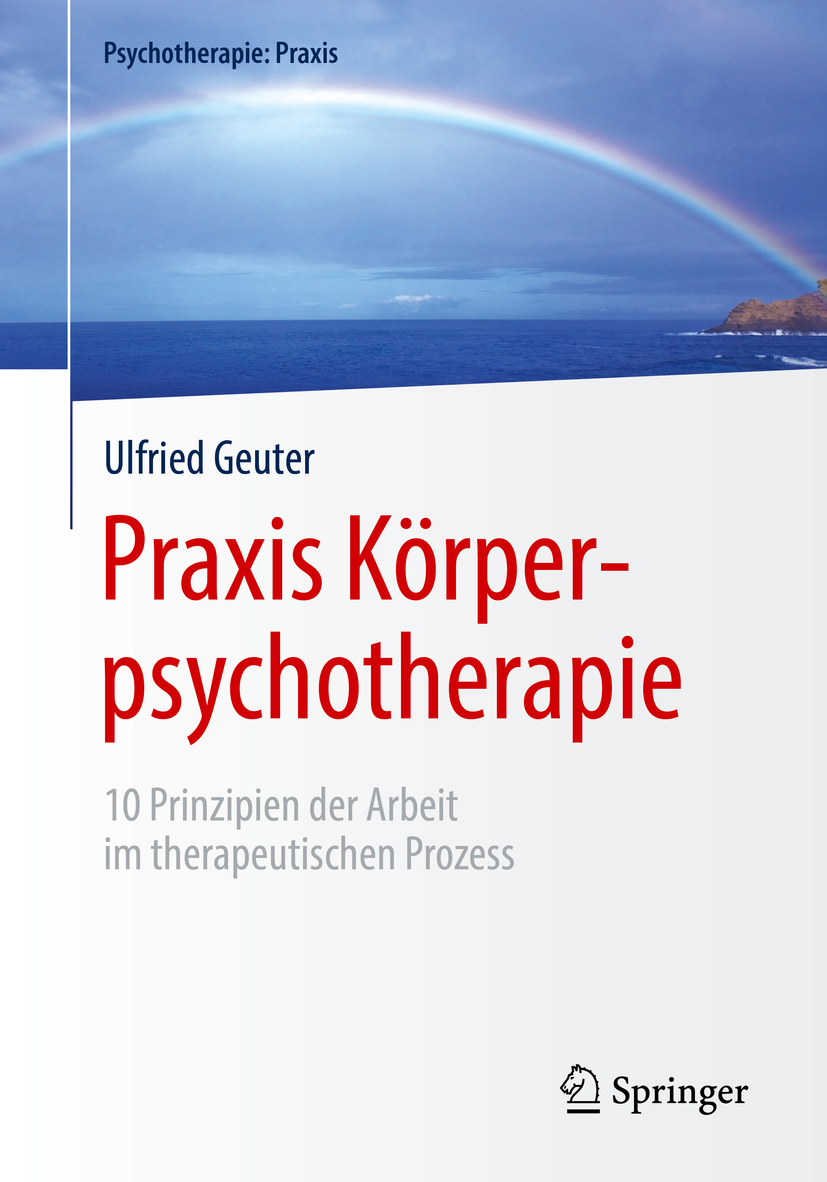
Praxis Körperpsychotherapie
|
Oder in der nächstgelegenen
Buchhandlung! So landen die Steuereinnahmen zumindest in
"unserem" Steuersäckel, was theoretisch eine
Investition in Bildung und Erziehung ermöglichen würde.
In Bonn-Bad Godesberg z.B. in der
Parkbuchhandlung

|